Kapitel 6
Die Theorie sozial-ökologischer Systeme
1Rainer Paslack & 2Jürgen W. Simon
1Dr. Rainer Paslack ist Soziologe, Philosoph und promovierter Humanbiologe, der gegenwärtig als wissenschaftlicher Mitarbeiter am SOKO Institut für Sozialforschung und Kommunikation in Bielefeld (Deutschland) tätig ist.
2Prof. Dr. Jürgen W. Simon war bis zu seiner Emeritierung Professor für Biotechnologie- und Umweltrecht an der Universität Lüneburg (Deutschland) und lehrt gegenwärtig an einer Universität in Hanoi (Vietnam).
- 6. Die Theorie sozial-ökologischer Systeme
- EINLEITUNG
- 6.1.Theoretischer Rahmen
- 6.1.1.Die problematischen Beziehungen zwischen Human- und Ökosystemen
- 6.1.2. Basiseigenschaften komplexer dynamischer Systeme
- 6.1.2.1.Selbstorganisation, „Umweltoffenheit“ und „operationale Geschlossenheit“
- 6.1.2.2. Resilienz und Robustheit
- 6.1.2.3.Beschränkte Vorhersagbarkeit von komplexen Systemprozessen
- 6.1.2.4.Komplexität, Gleichgewicht und Stabilität
- 6.1.2.5.Dezentralität, Hierarchie und Heterarchie, Emergenz und Skalenunterschiede
- 6.1.3. Verschiedene Ansätze zur Modellierung sozial-ökologischer Systeme
- 6.2.Systematische Indikatoren
- 6.2.1.Organisiertes Lernen durch Jugendbildung
- 6.2.2.Indikatoren für eine nachhaltige Entwicklung
- 6.2.3.Indikatoren für sozial-ökologische Produktionslandschaften
- 6.2.4.Sozio-ökologische Produktion
- 6.2.5.Resilienz
- 6.2.6.Über die Indikatoren
- 6.2.7.Wer kann von der Verwendung der Indikatoren profitieren?
- 6.2.8.Die zwanzig Toolkits
- 6.2.9.Bildung als der umfassende Faktor
EINLEITUNG
Im 4. Kapitel wurde aufgezeigt, welch überragende Bedeutung den „Ecosystem Services” (ES) für den Schutz der verschiedenen Ökosysteme vor Degradation und den Verlust an Biodiversität zukommt, insofern diese ein „interface between human and nature“ darstellen. Mit Hilfe dieser „Dienste“ wird versucht, den negativen anthropogenen Wirkungen auf die Ökologie des Planeten Einhalt zu gebieten bzw. solche bereits eingetretenen Effekte wieder auszugleichen. Umgekehrt soll der „Profit“ des Menschen von den wertvollen Ressourcen der Natur bewahrt und in gewissen Grenzen sogar gesteigert werden – ohne aber dass hierbei die Natur (und damit auch die Menschheit) in ihrem Bestand gefährdet oder auch nur dauerhaft in ihren wesentlichen Funktionen gestört wird.
In dem vorliegenden Kapitel werden diese ES-Ziele wieder aufgegriffen, indem ihnen bzw. den Wechselbeziehungen zwischen Mensch und Natur ein theoretisches Fundament verschafft wird, das auf grundlegenden Einsichten der allgemeinen Systemtheorie beruht, genauer: auf den Basisannahmen der Theorie komplexer und dynamischer Systeme, die sowohl für humane Sozialsysteme als auch für natürliche Ökosysteme relevant sind. Zugleich soll dieses Kapitel den Leser auch in das „systemische Denken“ einführen. Dürften die systemtheoretischen Begriffe doch nicht von vornherein jedem, der mit ihnen nicht bereits beruflich vertraut ist, verständlich sein, sodass es hier oft zu Missverständnissen oder Ratlosigkeit kommen kann. Daher soll im Folgenden nicht nur die Theorie „sozial-ökologischer Systeme“ vorgestellt, sondern sollen zuvor die Besonderheiten kurz erörtert werden, die insbesondere komplexe und dynamische Systeme gegenüber anderen (nicht-systemischen) Entitäten – wie etwa einfachen Dingen (Steinen, Werkzeugen usw.) – auszeichnen. Im Zusammenhang damit soll auch deutlich werden, mit welchen spezifischen erkenntnistheoretischen und methodologischen Problemen jede Systemtheorie zu kämpfen hat, die es unternimmt, die einzelnen Komponenten eines Systems (oder sogar mehrerer miteinander gekoppelter Systeme) und deren Wechselwirkungen zu bestimmen und zusammenhängend zu modellieren.
Denn die Systemtheorie modelliert und analysiert nicht nur die Dynamik einzelner (isolierter) Systeme im Austausch mit ihrer Umwelt, sondern auch das komplexe Zusammenspiel mehrerer Systeme, die wechselseitig füreinander Umwelt sind, indem sie untersucht, welche internen Auswirkungen jedes der Systeme auf das jeweils andere zur Folge hat: hierbei betrachtet sie die Interrelationen zwischen den verschiedenen Systemen gewissermaßen wie die Wechselwirkungen zwischen den Komponenten eines einzigen „Supersystems“, ohne allerdings die jeweiligen Besonderheiten der beiden „Komponenten“ (der Subsysteme) außer Acht zu lassen.
Im Rahmen dieses trans- oder intersystemischen Ansatzes hat sich in den letzten Jahrzehnten die für unseren Kontext maßgebliche „Theorie sozial-ökologischer Systeme“ (SES) herausgebildet, in der Humansysteme (Gesellschaften) und Ökosysteme (Natur) miteinander verklammert werden. Der SES-Ansatz ist ein „integrativer Ansatz“, der sozusagen die kausale Vernetzung von Systemen unterschiedlichen Typs erforscht und modelliert.
Unter einem „sozial-ökologischen System“ kann man grob das Folgende verstehen: Ein „sozial-ökologisches System“ (SES) ist ein System, „that includes societal (human) and ecological (biophysical) subsystems in mutual interactions” (Harrington et al. 2010: 2773). In einem solchen „adaptiven System“ wirken einerseits geophysikalische und biotische und andererseits soziale und kulturelle Faktoren auf eine Weise zusammen, dass das SES insgesamt resilient und nachhaltig zu existieren vermag: Alles ist hier in einem „ewigen Kreislauf“ befindlich, in dem zumindest stofflich prinzipiell nichts verloren geht, weil die freiwerdende Materie sofort wieder in den Kreislauf zurückgefüttert wird. Angetrieben wird die Dynamik dieses Systems von der Energie der Sonne und des Erdinneren (auch dann, wenn sie aus fossilen Lagerstätten erst wieder freigesetzt werden muss). Und alles ist hier Wechselwirkung: sowohl innerhalb der Ökosphäre und der Humansphäre als auch zwischen diesen beiden Sphären: der Mensch wirkt auf die Natur ein und diese wiederum auf den Menschen, sodass der Mensch die Natur nur scheinbar zu beherrschen vermag, in Wahrheit aber immer nur in einem Austausch mit ihr steht. Aus der Natur gibt es kein Entkommen, doch auch die Natur bleibt von den Aktivitäten des Menschen nicht unberührt – so man überhaupt Mensch und Natur einander gegenüberstellen will, denn diese Unterscheidung verdankt sich lediglich einer Perspektive, die alles Nicht-Menschliche vom Menschen her klassifiziert und bewertet („Anthropozentrismus“). Nun ist zwar auch die Wissenschaft nicht „wertneutral“, insofern sie immer von menschlichen Interessen getragen und angetrieben wird, aber die Wissenschaft bemüht sich zumindest um einen objektiven Blick (einen „Blick von Nirgendwo“), wodurch sie die Einseitigkeiten einer bloß subjektiven Betrachtungsweise insofern überwindet, als sie diese kritisch bewertet und zu vermeiden versucht. Schon deshalb brauchen wir die Wissenschaft, wenn wir die Wechselwirkungen zwischen der Öko- und der Humansphäre in einer möglichst vorurteilsfreien Weise verstehen möchten. Und hier sind es die Forschungsansätze der verschiedenen SES-Theorien (und die auf ihnen aufbauenden empirischen Studien), die uns einem Verständnis sozial-ökologischer Zusammenhänge auf eine Weise nahebringen, die der Komplexität dieser Zusammenhänge angemessen ist.
Im Folgenden soll es jedoch nicht darum gehen, die Geschichte des SES-Ansatzes in allen ihren zahlreichen Varianten nachzuzeichnen, sondern darum, jene theoretischen Vorstellungen und für die Praxis relevanten Erkenntnisse zu präsentieren, die für eine Stärkung der „public awareness“ im Hinblick auf die nachhaltige Erhaltung oder Erneuerung natürlicher Ressourcen und Lebensbedingungen unerlässlich sind. Dieses Kapitel ist in zwei größere Abschnitte gegliedert: „Theoretischer Rahmen“ (7.1) und „Systematische Indikatoren“ (7.2).
Das Unterkapitel 7.1. (Autor: Rainer Paslack) verfolgt die folgenden Ziele bzw. Fragestellungen:
- Was sind die Gründe dafür, dass wir die Welt als ein umfassendes sozial-ökologisches System betrachten sollten?
- Welches sind die wichtigsten Merkmale von komplexen dynamischen Systemen in Gesellschaft und Natur?
- Was leistet die Theorie „sozial-ökologischer Systeme“?
Das Unterkapitel 7.2. (Autor: Jürgen Simon) ist den folgenden Zielen bzw. Fragestellungen gewidmet:
- Mit welchen Indikatoren („key tools“) arbeitet die SES-Forschung?
- Auf welche Weise können diese Indikatoren das Monitoring sozial-ökologischer Systeme (SES) unterstützen?
6.1. Theoretischer Rahmen
6.1.1.Die problematischen Beziehungen zwischen Human- und Ökosystemen
Wir alle leben in einer überaus komplexen und dynamischen Welt. Niemand vermag mehr die Vielzahl und Vielfalt an Komponenten und deren komplexes Zusammenspiel zu überblicken, die zusammen das ergeben, was wir als „unsere Wirklichkeit“ bezeichnen. Im Zuge der modernen Globalisierung der Welt in Wirtschaft, Politik und Kultur wurde die Erde mit einem riesigen und unüberschaubaren Netzwerk von Verkehrsverbindungen überzogen, auf denen bei Tag und Nacht zahllose Menschen und Güter sowie Daten transportiert werden. Und obwohl es zahlreiche internationale Abkommen gibt, die diesen „Dschungel“ zu ordnen und zu regeln versuchen, verläuft dieser Prozess insgesamt eher „wildwüchsig“, da in den zumeist neoliberalen Wirtschaftssystemen, zumal der westlichen Welt, die transnational aktiven Unternehmen vorrangig nach betriebswirtschaftlichen Effizienz- und Renditekriterien handeln und jede sich ihnen bietende Chance ergreifen, weitere gewinnbringende Produkte zu entwickeln und neue Märkte zu erschließen, wo immer dies gerade möglich ist und opportun erscheint.
Insbesondere die Landwirtschaft, die eine wachsende Menschheit ernähren bzw. den steigenden Wohlstandsansprüchen genügen muss, dehnt sich immer weiter über alle Bodenflächen aus, die überhaupt genutzt werden können. Weder die „unsichtbare Hand“ des Marktes, die es eigentlich gar nicht gibt, noch die Gemeinschaft der Staaten ist offenbar in der Lage, hier regulierend einzugreifen und dem allgemeinen Wildwuchs Paroli zu bieten. Die ökonomische Globalisierung der Erde verläuft somit weitgehend blind, d.h. in der Form eines sich selbstorganisierenden Prozesses, an dem zahllose Akteure mit ihren oft konkurrierenden Interessen beteiligt sind. Natürlich verfolgt jedes einzelne Unternehmen und jeder einzelne Staat seine eigenen Ziele mit Bedacht, d.h. planvoll, systematisch und rational; auch gibt es so gut wie überall einen gesetzlichen Rahmen, der eingehalten werden muss (freilich etwa auch „Steueroasen“, die den Wirtschaftssubjekten viele Freiheiten einräumen). Doch aufs Ganze gesehen konkurrieren die vielen Unternehmungen der zahllosen Akteure in einer unübersichtlichen Weise; und nicht selten sind gerade die globalen ökonomischen Verflechtungen derart intransparent, dass vor allem an den Finanzmärkten Bewegungen in Gang kommen, die sich jeder Kontrolle entziehen und leicht zu chaotischen Zuständen führen können. Aber auch z.B. der internationale Tourismus, der ebenfalls industriell organisiert ist, trägt zu diesem erdumspannenden Vorgang bei. Nicht nur die Staaten und Unternehmen, auch jeder Einzelne von uns ist also an der fortschreitenden Globalisierung und an deren im Detail unabschätzbaren „Nebenwirkungen“ für Gesellschaft und Natur beteiligt. Es gehört zum Wesen komplexer Systeme, das in ihnen immer Vieles und Unterschiedliches gleichzeitig geschieht und es hierbei zu Diskrepanzen, Unverträglichkeiten, aber auch Verknüpfungen (temporären Allianzen) und Überschneidungen kommen kann, sodass schließlich riskante Entwicklungen oder unerwünschte Trends entstehen, die mitunter erst spät bemerkt werden und noch schwerer zu beherrschen sind.
Dieser Prozess wird zudem begleitet von einer wachsenden Technisierung aller Lebensbereiche und noch der letzten Winkel auf unserem Globus, die auch vor den entlegensten „Reservaten“ der Natur nicht Halt macht: Der ungebremste Hunger der menschlichen Zivilisation nach immer mehr und immer besseren Gebrauchs- und Konsumgütern sowie nach einer immer engmaschigeren und leistungsfähigeren Infrastruktur, nach Straßen und Kanälen, nach Fabrik- und Wohnanlagen, nach weiteren Energiequellen und Rohstoffen führt nicht nur zu einer zunehmenden Ausbeutung der Natur z.B. durch Landverbrauch („land grabbing“) und die Erschließung immer neuer Wasser- und Rohstoffressourcen, sondern auch zu immer engeren und intensiveren Wechselwirkungen zwischen dem Menschen und der Natur. Die negativen Folgen dieser Entwicklung sind hinlänglich bekannt: Bodenversiegelung und Wasserverschmutzung, Artenschwund und Klimawandel bilden hier nur die größten Posten auf der negativen Seite der Bilanz innerhalb der Mensch-Umwelt-Beziehungen. Inzwischen werden sowohl die „Grenzen des Wachstums“ als auch die Umweltkosten immer sichtbarer. Vor allem die steigenden Umweltkosten könnten unserem Verlangen nach weiterem Wohlstand und ökonomischem Reichtum schon bald ein Ende bereiten und sogar ganze Volkswirtschaften in die Knie zwingen. Daher wächst allmählich die Bereitschaft, unser Verhalten gegenüber der Natur zu verändern und insbesondere unsere Wirtschaft „umzusteuern“, indem wir etwa erneuerbare Energien (Sonne, Wind und Wasserkraft) technologisch zu nutzen versuchen, verbrauchte Rohstoffe wieder in den Wirtschaftskreislauf einspeisen („Recycling“) oder natürliche Rohstoffe durch künstliche Materialien substituieren bzw. einsparen. Hierbei kommt vor allem der Reduktion von Schadstoffemissionen (wie CO2, Methan und Feinstoff-Aerosolen), die regelrechte „Klimakiller“ sind und zudem die Gesundheit schwer beinträchtigen können, eine herausragende Rolle zu. Außerdem werden der Natur vielerorts Rückzugs- und „Erholungsgebiete“ eingeräumt (etwa in den Auenwäldern und Regenwaldzonen, in den Mooren und anderen Feuchtbiotopen), werden die Land- und Forstwirtschaft auf einen „ökologischen Anbau“ umgestellt und die Gewinnung sowie Nutzung der knapper werdenden Naturressourcen einem strengen Verbrauchs- und Nachhaltigkeitsmanagement unterzogen. Aber bislang wurde hier allenfalls ein Anfang gemacht – und die Zeit bis zum möglichen Umwelt- und Klimakollaps wird immer kürzer (zumal niemand weiß, wo die „tipping points“ liegen, an denen das Klima in ein neues „Regime“ irreversibel umkippt).
Von besonderer Bedeutung ist bei all dem das Umweltmanagement, das an der Schnittstelle zwischen Mensch und Natur operiert. Natürlich sind auch die sozial-kulturellen Systeme der Vergangenheit niemals von den ökologischen Systemen der Natur abgekoppelt gewesen, sodass es auch früher schon gelegentlich zu vom Menschen verursachten „Umweltkrisen“ gekommen ist: etwa durch Abholzungen für den Haus-, Schiffs- und Grubenbau oder für das Brennholz, das zum Heizen und Kochen in größeren Ansiedlungen oder für den Betrieb von Schmelzöfen benötigt wurde; auch bereits die sowohl extensive als auch intensive Beweidung von Wiesen und Savannen sowie eine übermäßige Bejagung von Wild oder eine exzessive Ausbeutung von Fischgründen, die Umleitung von Bächen für den Betrieb von Wassermühlen oder die Verschmutzung von Gewässern durch Gerbereien und Färbereien oder für die Papierherstellung haben schon relativ früh in der Menschheitsgeschichte für gravierende Umweltschäden oder Naturbelastungen gesorgt. Daher lassen sich erste zaghafte Maßnahmen z.B. für den Gewässer-, Boden- und Waldschutz bereits bei den Sumerern und alten Ägyptern sowie auch im antiken Indien und China und sogar bei den präkolumbischen Kulturen des alten Amerika nachweisen.
Doch die damals zu bewältigenden Umweltprobleme, die sich aus einem prekären Wechselspiel zwischen den menschlichen Nutzungsansprüchen und dem begrenzten Vermögen der Natur zu ihrer Selbstregeneration ergaben, waren nichts im Vergleich zu den Problemen, die sich uns heute stellen, da erkennbar die Existenz des Menschen (und mit ihm zahlreicher Pflanzen- und Tierspezies) auf dem Spiele steht. Nunmehr wird ein Umweltmanagement, das alle relevanten Faktoren berücksichtigt, unverzichtbar, ja überlebensnotwenig. Aber dies ist leichter gefordert als in die Tat umgesetzt! Beherrschen wir doch, wie oben mit Bezug auf die ökonomische Globalisierung und eine im Ganzen ungeregelte Technisierung aller Lebensbereiche schon angedeutet worden ist, noch nicht einmal unsere eigenen sozioökonomischen Systeme, in denen wir miteinander umgehen, kommunizieren, produzieren und Handel treiben. Denn nicht nur die Bewegungen an den Güter-, Dienstleistungs- und Finanzmärkten sind aufgrund ihrer intransparenten Strukturen und globalen Verflechtungen immer undurchschaubarer geworden, sondern auch die politischen und interkulturellen Verhältnisse sind derart verworren, teilweise auch instabil und polarisiert, dass wir auch hier Anlass zur Sorge haben. Daher erscheint vielen Zeitgenossen eine intakte Natur geradezu als das (utopische) Gegenbild zu den verworrenen und prekären Verhältnissen innerhalb der „Weltgesellschaft“ miteinander konkurrierender Staaten und sozialer sowie religiös-fundamentaler Bewegungen und Gruppierungen. Aber dies täuscht: Denn auch in der Natur ist alles in einem ständigen Fluss begriffen, ist es in der Erdgeschichte schon wiederholt zu gewaltigen „Naturkatastrophen“ (etwa zu „big extinctions“ von vielen Spezies) gekommen. Und überhaupt ist das, was wir heute an Artenvielfalt und Klimaverhältnissen auf der Erde beobachten können, das Ergebnis einer natürlichen Evolution, die sich über mehrere Jahrmilliarden hingezogen hat. Und sogar innerhalb eines einzelnen Biotops herrschen nicht nur schiere Harmonie und friedvolle Kooperation (i.S. von Geselligkeit oder Symbiose), sondern vor allem ein allseitiger Überlebenskampf um knappe Nahrungsressourcen, der immer wieder zu instabilen Situationen und die Resilienz (Widerstandsfähigkeit) des Biotops an seine Grenzen führt: Neue vorteilhafte Mutationen verschaffen der einen Art einen Überlebensvorteil gegenüber einer anderen Art oder die Einwanderung von fremden Arten setzt ungeahnte Selektionskräfte frei, die in die Verdrängung oder sogar Ausrottung endemischer Arten einmünden können. Aber es stimmt schon: Bisweilen bleiben Biotope oder spezielle Ökosysteme über eine längere Zeit hinweg relativ stabil, indem es ihnen immer wieder gelingt, etwaig auftretende Fluktuationen (Schwankungen in der Zusammensetzung oder der inneren Dynamik des Systems) auszudämpfen.
Und eine vergleichbare Beherrschung von gefährlichen Fluktuationen wird natürlich auch in den menschlichen Sozialsystemen angestrebt: vor allem über die Ausbildung von Wert- und Rechtssystemen und die Etablierung von exekutiven Institutionen (wie etwa der Verwaltung oder der Polizei), um „Recht und Ordnung“ sowohl herzustellen als auch zu kontrollieren und aufrechtzuerhalten. Hierbei spielen kooperative, verwaltungstechnische und arbeitsteilige Prozesse, aber auch klare Zuweisungen von sozialen Rollen mit bestimmten Rechten und Pflichten sowie auch politische Herrschaftsverhältnisse eine entscheidende Rolle. Und damit dies alles funktioniert, bedarf es des Vertrauens der Bürger in die Legitimität und die Nicht-Korruptheit der Staatsführung; aber auch in die Gerechtigkeit der Gesetzgebung und die Angemessenheit der Rechtsdurchsetzung. Solange dieses Grundvertrauen in die staatlichen Institutionen beim Großteil der Bevölkerung gegeben ist, wird auch das Gesellschaftswesen weitgehend reibungslos funktionieren können und Bestand haben (andernfalls Aufstände oder sogar revolutionäre Umbrüche drohen).
Dies stellt sich in der Natur ganz anders dar: Denn einmal abgesehen von gewissen „freundlichen“ konvivialen Beziehungen innerhalb von Tiergesellschaften (etwa bei Menschenaffen) oder von der rigorosen arbeitsteiligen Organisation innerhalb von Bienen- oder Ameisenvölkern, dominiert in der Natur vorwiegend die „körperliche Überlegenheit“, sodass hier Gewalt und „natürliche Intelligenz“ den Ton angeben. Kurzum: hier bestimmt das „Gesetz von Fressen und Gefressenwerden“ das biologische Naturgeschehen. Und nur innerhalb von Tiergruppen ab einer bestimmten Entwicklungsstufe (wie bei den Säugetieren und Vögeln) sind auch ein kooperatives Verhalten, Fürsorge und sogar Hilfsbereitschaft beobachtbar, da hier die einzelnen Individuen für ihr Überleben und Wohlergehen aufeinander angewiesen sind. Damit wird bereits eine Vorstufe erreicht, auf der immerhin schon ein „soziales Lernen“ in einem rudimentären Umfang möglich ist. Diese Entwicklung nimmt dann schließlich beim Menschen seine ausgeprägteste Form an. Denn in humanen Sozialsystemen wird die Gewaltbereitschaft (Aggressivität) in der Regel durch die Akzeptanz von moralischen Spielregeln (Werten und Normen) und durch ritualisierte Formen des Verhaltens „kanalisiert“ und dadurch in Schranken gehalten. Im Idealfall kann diese friedfertige Organisation aller menschlichen Belange die gesamte Menschheit umfassen – wovon wir aber derzeit noch weit entfernt sind, wie die kriegerischen Auseinandersetzungen in etlichen Regionen der Erde zeigen. Es gehört deshalb zu den größten und schwierigsten Aufgaben jeder menschlichen Gemeinschaft und Gesellschaft, das innere Gewaltpotenzial jedes Menschen, das ein Erbteil aus der biologischen Evolution ist, etwa durch Erziehung und juristische Strafandrohung möglichst gering zu halten bzw. auf harmlose Verhaltensbereiche umzulenken (wie etwa auf den Sport, aber auch auf das staatlich geregelte Konkurrieren um Marktvorteile, Karrierechancen usw.). Da dies einer Gesellschaft aber immer nur nach innen hin möglich ist, unterhält sie in der Regel außerdem noch eine Armee, die sie im Ernstfalle gegenüber äußeren Feinden verteidigen kann.
Warum jedoch alle diese langen Ausführungen zur Struktur und Funktionsweise von sozialen Systemen, wo es doch in diesem Beitrag um sozial-ökologische Systeme geht? Der Grund hierfür ist, dass es bei dieser Art von Systemmodellierung eben nicht nur um Ökologie, sondern immer auch um Soziologie und andere Sozial- und Kulturwissenschaften geht – ja, gehen muss! Es ist uns wichtig, auf die charakteristischen Unterschiede in der Eigenart von naturalen Ökoystemen und kulturellen Humansystemen hinzuweisen. In den SES-Theorien wird die Kenntnis dieser Unterschiede zumeist vorausgesetzt – mit der Folge, dass das Zusammenwirken dieser unterschiedlichen Systemtypen nur unvollständig verstanden wird und oft sogar Missverständnissen Vorschub leistet. Die Qualität und Stärke des „systemischen Denkens“ zeigt sich aber auch daran, inwieweit die besonderen Eigenheiten unterschiedlicher Systemtypen bewusst geworden sind. Denn nur dann können auch die intersystemischen Beziehungen angemessen verstanden werden. Die erkenntnistheoretischen (epistemologischen) Voraussetzungen für die Beschreibung und das Verständnis von humanen Sozialsystemen sind teilweise sehr verschieden von denen für die Analyse von Ökosystemen – ja, in mancher Hinsicht diesen sogar entgegengesetzt. Eine vollständige SES-Theorie muss daher beiden Systemtypen gerecht zu werden versuchen. Zumindest aber ist es von Vorteil, sich die unterschiedlichen Funktionsweisen beider Systemformen bewusst zu machen. Versäumt man dies, dann kann es leicht zu bestimmten Fehleinschätzungen kommen, von denen mitunter auch die Wissenschaft nicht verschont bleibt: Ein berühmtes Beispiel liefert der so genannte „naturalistische Fehlschluss“, der darin gründet, dass man aus der Beobachtung, dass in der Natur offenbar immer der Stärkere überlebt, die Vorstellung ableitet, dass es auch in der menschlichen Gesellschaft ein „Recht des Stärkeren“ gebe bzw. geben sollte (was zu den bekannten „sozialdarwinistischen“ Ideologien führt). Allgemein gilt: Sowohl die dezidierte Kampfstellung gegen die „gefährliche Natur“ als auch der Versuch, die angeblich so „harmonische Natur“ zum Vorbild für das menschliche Verhalten zu erheben, sowie auch die Vorstellung, die Natur sei nur ein „Vorrat“ an wirtschaftlich verwertbaren Stoffen und Energien, aus dem man sich nach Gutdünken bedienen kann, sind nur Ausdruck einer defizitären Bewusstseinshaltung, der es an Differenzierungsvermögen mangelt. Insbesondere an der Frage, ob und gegebenenfalls was wir von der Natur lernen können, scheiden sich von jeher die Geister. Um nur zwei der häufig gestellten Fragen anzuführen: Gibt es ein universal gültiges „Naturrecht“? Gibt es „natürliche Lebensmittel“, sodass gentechnisch modifizierte Nahrungsmittel abzulehnen sind? Zu einer angemessenen Antwort kann gerade auch eine Systemtheorie, die sich für die unterschiedliche Funktionsweise verschiedener Systeme sensibel gemacht hat, Wesentliches beitragen.
Fragen wir z.B., ob die in der Natur herrschenden Gesetze (etwa die der „natürlichen Selektion“) für die Organisation menschlicher Gemeinschaften ein Leitbild liefern können, indem man sie für die Stabilisierung der sozialen Dynamik und für die Einhegung der oben erwähnten „Aggressionsneigung“, die dem Menschen offenbar angeboren ist, übernimmt. Fragen wir mithin: Sind autoritäre Staatsregime eher dazu in der Lage, die Gewaltbereitschaft ihrer Bürger im Zaume zu halten, indem sie diese mit polizeilichen und geheimdienstlichen Maßnahmen kontrolliert, als demokratische Gemeinwesen, die bei der rechtsförmigen „Unterdrückung“ von zwischenmenschlicher und politischer Gewalt auf die freie Zustimmung ihrer Bürger angewiesen sind, um legitim sein zu können? Und sind solche diktaturähnlichen Staatswesen daher stabiler als Demokratien? Antwort: Systemtheoretisch gesehen, lässt sich diese Frage grundsätzlich nicht bejahen, da autoritäre Regime nach einer gewissen Zeit immer zur Mobilisierung von innerem Widerstand und sodann auch zu Aufständen führen; auch im Falle von Naturkatastrophen (z.B. Erdbeben und Überschwemmungen) reagieren sie oft schwerfälliger; und schließlich können hier auch wirtschaftliche Notlagen auf der Grundlage von zentralen Wirtschaftsplanungen eher schlecht gemeistert werden, da dem individuellen Handeln zumeist ein zu geringer Spielraum zugestanden wird (zumindest gilt dies für extreme Formen einer nach innen hin repressiven Herrschaft). Daher können „freie Gesellschaften“, in denen den demokratischen und bürgerlichen Freiheitsrechten des Individuums eine hohe Bedeutung beigemessen wird, nicht unbedingt als instabiler oder krisenanfälliger gelten als autoritär geführte Staaten oder kollektivistisch organisierte Gemeinwesen. Denn liberale Gesellschaften zeichnen sich in der Regel durch einen hohen Grad an Innovativität (Ideenreichtum) und eine nicht geringe Anpassungsfähigkeit (Flexibilität) in Krisenzeiten aus.
Betrachtet man nun moderne bürgerliche Gesellschaften vom demokratisch-rechtsstaatlichen Typus, dann fällt auf, dass sie aus einem „Gemisch“ von sich selbstorganisierenden (informellen) Prozessen einerseits und von politisch-rechtlich geregelten (aus der Perspektive der Individuen also „fremdorganisierten“) Prozessen bestehen. Dies liegt natürlich daran, dass der Mensch zu sich selbst eine „reflexive Distanz“ einnehmen, d.h. über sein Handeln und Wollen nachdenken und gegenüber anderen Personen Verantwortung übernehmen bzw. Rechenschaft ablegen kann. Eine solche „Mischung“ oder Überlagerung finden wir hingegen bei ökologischen Systeme in der Natur nicht (solange wir nicht von außen in sie eingreifen): Natürliche Ökosysteme sind vielmehr durchgängig selbstorganisiert – denn hier gibt es keine „steuernden Instanzen“, die den „blinden“ Naturabläufen etwas entgegensetzen würden: also keine kooperative Planung oder eine Evaluation von durchgeführten Maßnahmen, um deren Resultate zu korrigieren oder die Instrumente und Methoden des Handelns zu optimieren. Nur der Mensch scheint dazu in der Lage zu sein, die Konsequenzen seines Tuns zu bewerten und aus ihnen nachhaltig zu lernen (ja solche Konsequenzen in Grenzen sogar vorauszusehen), neue technologische Entwicklungen zu stimulieren und voranzutreiben sowie die Formen seines kollektiven Handelns immer wieder zu reorganisieren, falls dies notwendig oder sinnvoll erscheint. Von all dem kann in der Natur nicht die Rede sein.*1* Eine Ackerfläche entsteht nicht von selbst, sondern ist das Resultat einer geplanten Urbarmachung von Wildnis, denn sie muss der Natur erst abgerungen werden. Natürlich strukturieren auch viele (vielleicht sogar alle) Lebewesen ebenfalls ihre Umwelt nach Maßgabe ihrer „Interessen“ und Lebensgewohnheiten (man denke z.B. an die Burgen des Bibers oder an Termitenhügel, die die vorhandene Landschaft stark verändern und prägen können; oder auch an Korallenriffe und Guanovogelkolonien), aber unterhalb der Primatenstufe vollziehen sich alle diese Aktivitäten auf der Grundlage eines angeborenen Instinktprogramms, denn die nicht-humanen Lebewesen können gar nicht anders, als sich so oder so zu verhalten. Weshalb man zu Recht ein bloß instinktives oder reflexartig-reaktives Verhalten vom menschlichen Handeln zu unterscheiden pflegt: denn erst das Handeln erfolgt absichtsvoll und gezielt, wobei in der Regel auch Handlungsalternativen bestehen, zwischen denen eine „freie Wahl“ getroffen wird. Offenbar ist nur der Mensch dazu imstande, im vollen Sinne zweckgerichtet und begründet zu handeln, indem er Prioritäten setzt und mit Hilfe seiner Vorstellungskraft Pläne schmiedet. Hieraus entspringt denn auch die besondere Verantwortlichkeit des Menschen für seine Taten bzw. Unterlassungen: Nur vom Menschen kann man eine Rechtfertigung für seine Handlungen einfordern. Zwar können auch höhere „intelligente“ Tiere gelegentlich „tricksen“, indem sie ihre Artgenossen z.B. über die Lage einer versteckten Beute offenbar bewusst täuschen, doch wir würden sie deshalb nicht zur Rechenschaft ziehen oder ihnen eine Schuld zuweisen. Erst vom Menschen könnte man hier ein „schlechtes Gewissen“ erwarten, weil oder falls er dabei gegen eine bestehende moralische oder rechtliche Norm verstoßen hat. Mancher wird vielleicht entgegnen, dass sein Hund sehr wohl weiß, wenn er etwas „Schlechtes“ getan hat. Doch es ist wohl eher so, dass der Hund bloß merkt, dass sein Halter über ihn verärgert ist und er daher dessen Zorn fürchten muss. – Doch dass allein der Mensch ein „sittliches“, nämlich verantwortliches Wesen ist, bedeutet nicht, dass anderen Lebewesen keinerlei „ethischer Wert“ zugebilligt zu werden braucht: dass z.B. ein Fuchs sich nicht an einem „Hühnerdiebstahl“ schuldig machen kann, rechtfertigt nicht, dass der Mensch ihn wie irgendeine „Sache“ behandeln darf, da der Fuchs ein empfindungsfähiges Wesen ist, dass zu leiden vermag, sodass hier für den Menschen ein Verbot der Leidzufügung besteht. Der Mensch darf zwar seinen Hühnerbesitz gegen den Fuchs verteidigen, aber ohne dem Tier hierbei vermeidbares Leid zuzufügen. Vor allem aber ist auch einem Raubtier ein unbedingtes Lebensrecht zuzugestehen, da auch dieses über einen moralisch relevanten „intrinsischen Lebenswert“ verfügt. Der Tierschutz dient nicht nur der Arterhaltung, sondern pocht auch auf das Wohlergehen jedes einzelnen Individuums jeder empfindungsfähigen Tierart. Die Erhaltung der Biodiversität auf diesem Planeten sollte daher nicht nur aus Eigeninteresse, sondern auch aus ethischem Respekt vor allem Lebendigen geschehen. Naturschutz ist insofern auch eine „ethische Pflicht“. (Nähere Erläuterungen hierzu findet der Leser in Paslack 2012, S. 65 ff.)
Und die Fähigkeit des Menschen, aus Fehlschlägen (Fehlplanungen) zu lernen, ist auch unbedingt erforderlich, denn in komplexen gesellschaftlichen Zusammenhängen (etwa bei einer umfassenden Reform des Steuer- oder Gesundheitswesens oder beim Versuch einer Neuausrichtung von Wirtschaftsabläufen) ist es häufig nicht oder nur begrenzt möglich, die potenziellen Auswirkungen eines innovativen Handelns vorauszusehen. Und schon die Einschätzung der Langzeitfolgen eines gewohnten Handelns kann überaus schwierig sein – wie das Beispiel des fortgesetzten „Raubbaus“ an den Naturschätzen eindrücklich zeigt, wo der Mensch in den frühen Phasen der Industrialisierung reichlich „naiv“ davon ausging, dass die Rohstoffvorräte und Energiereserven des Planeten unerschöpflich seien. Diese Einstellung hat sich inzwischen grundlegend geändert. Aber noch immer verhalten sich einige Politiker und Wirtschaftsexperten faktisch so, als glaubten sie, mit der Natur verhandeln zu können – so wie sie es auf den Parketten der internationalen Diplomatie gewohnt sind. Aber der Natur kann man keine „Angebote“ machen, etwa um Zeit zu gewinnen, bevor ein wichtiger „tipping point“ erreicht wird, nach dem der Klimawandel und alle damit verbundenen Konsequenzen (wie Artensterben, Anstieg des Meeresspiegels, Ausbreitung der Wüstenzonen) ihren unabänderlichen Lauf nehmen.*2* Denn genau das ist ja das Problem: Die Natur folgt einfach nur immer ihren eigenen und unabänderlichen Gesetzen und lässt nicht mit sich reden. Was immer hier an kumulativen oder systemisch rückkoppelnden Effekten auftritt (etwa im Falle einer fortschreitenden Versauerung der Meere oder bei der zunehmenden Freisetzung von Methan aus den sibirischen Permafrostböden aufgrund einer „positiven Rückkopplung“ zwischen steigenden Temperaturen und Methanemissionen), es geschieht einfach, weil es aufgrund der geltenden Naturgesetze eben so geschehen muss (und nicht nur kann, sodass es eine Art „Verhandlungsspielraum“ geben könnte). Während also die „positive Gesetzgebung“ in den Humangesellschaften immer wieder rechtliche Anpassungen in Form von Gesetzesnovellen gestattet, gelten die Naturgesetze absolut und unumstößlich. Das Einzige, was der Mensch in einer solchen Lage tun kann ist, die obwaltenden Naturgesetze entweder durch Zurückhaltung zu respektieren, indem er behutsam und nachhaltig mit den Naturschätzen umgeht (etwa indem er Wiederaufforstung betreibt oder den Fischbeständen Erholungszeiten einräumt), oder auf technologische Weise, indem er etwa neue (nicht-fossile) Energiequellen erschließt (etwa durch Windkraft- und Photovoltaikanlagen) bzw. die Produkte seines wirtschaftlichen Handelns von vornherein so strukturiert, dass sie wiederverwendet („recycelt“) werden können, um auf diese Weise den Verbrauch an neuen Rohstoffen möglichst zu reduzieren. Anders gesagt: Der Mensch kann immer nur mit den Naturgesetzen handeln, indem er sie beachtet bzw. technologisch nutzt, nicht aber gegen sie.
Dies mag eine Binsenweisheit sein, führt aber zu erheblichen Konsequenzen für jedes Systemmanagement an der Schnittstelle zwischen Mensch und Natur. Denn während wir das Verhalten von Ökosystemen immer nur insoweit planvoll ändern können, wie dies im Rahmen der geltenden Naturgesetze (oder der auf diesen basierenden Genetik) möglich ist, können wir die Regeln und Muster unseres eigenen Verhaltens in einem weitaus größeren Maße ändern, da wir in unserem Handeln im Unterschied zu den meisten anderen Lebewesen nicht (oder nur rudimentär) an Instinktprogramme gebunden sind, sodass wir die Angemessenheit unserer Verhaltensweisen und Institutionen überdenken und diese grundsätzlich auch nach Belieben transformieren können. Genau ein solches Überdenken unserer Handlungsweisen und der Leistungsfähigkeit unserer Institutionen scheint gegenwärtig erforderlich zu sein, um die zentrale Frage des Managements sozial-ökologischer Systeme beantworten zu können: Wie können wir in der Entwicklung der Mensch-Natur-Beziehung die „Kontrolle“ gewinnen, damit diese Beziehung nicht ins sozial-ökologische Chaos führt? Dazu müssen wir offenbar nicht nur verstehen, wie Ökosysteme funktionieren, sondern auch in unserem „eigenen Hause“ zumindest so viel Ordnung schaffen, dass ein geordnetes und aussichtsreiches Vorgehen beim sozial-ökologischen Management überhaupt möglich wird! Folglich müssen wir nicht nur die „kritischen Punkte“ innerhalb der Dynamik ökologischer Systeme, sondern auch die „neuralgischen Punkte“ innerhalb der Humangesellschaften identifizieren und zu beherrschen lernen. Eine Neuordnung der Mensch-Natur-Beziehung setzt also eine Neordnung der weltgesellschaftlichen Verhältnisse voraus, die vor allem die Ein- und Ausrichtung der globalen Wirtschaft betrifft. Andernfalls werden alle die schönen Theorien sozial-ökologischer Systeme, die bereits entwickelt worden sind, weitgehend Makulatur bleiben.
Was bedeutet dieser Befund nun für die Aufgaben und Vorgehensweisen eines Managements, das versucht, die sozialen Strukturen, ökonomischen Interessen und technischen Operationsweisen menschlicher Gesellschaften mit den Strukturen, Prozessen und Gesetzen der für unser Überleben und Wohlergehen wichtigen Ökosysteme in Einklang zu bringen? Ein solches Management wird selbst einen systemischen Charakter annehmen müssen. Und es wird das Spiel der Wechselwirkungen zwischen den humansozialen und den ökologischen Systemen letztlich wie ein einziges großes System behandeln müssen, in dem die die humanen und die ökologischen Systeme mit ihrer jeweils eigenen Dynamik gewissermaßen „Subsysteme“ bilden, die dabei nicht unabhängig voneinander operieren, sondern sich an zahllosen Punkten berühren und immerzu beeinflussen. Daher lag es nahe, eine Theorie so genannter „sozial-ökologischer Systeme“ zu entwickeln, um insbesondere das Zusammenspiel von Ökologie und Ökonomie (aber auch noch von anderen menschlichen Praxisbereichen) in Modellen abbilden sowie aus diesen Erkenntnisse gewinnen zu können, die es uns erlauben, jede bewusste Intervention in die natürliche Umwelt, aber auch jeden sonstigen Effekt auf diese, abschätzen und bewerten zu können. Dies stellt ein ungemein schwieriges Unterfangen dar, das vor allem an die methodische Vorgehensweise hohe Ansprüche stellt: um ein sachlich angemessenes und für praktische Zwecke instruktives Modell erstellen zu können, müssen z.B. alle relevanten Komponenten des Systems, alle Konstanten und Variablen, bestimmt sowie Indikatoren erarbeitet werden, mit deren Hilfe wir die laufenden Veränderungen in einem sozial-ökologischen System (und damit auch den Erfolg oder Misserfolg unserer umweltbezogenen Maßnahmen) beobachten können. Dies stellt die Theorie und Modellbildung vor eine gewaltige Aufgabe, die nicht auf einen Schlag, sondern nur nach und nach gelöst werden kann, indem wir Erfahrungen sammeln und diese immer wieder in das Modell einspeisen, sodass es allmählich eine aussagekräftige und praktisch nutzbare Form annimmt.
*1*Eine Ackerfläche entsteht nicht von selbst, sondern ist das Resultat einer geplanten Urbarmachung von Wildnis, denn sie muss der Natur erst abgerungen werden. Natürlich strukturieren auch viele (vielleicht sogar alle) Lebewesen ebenfalls ihre Umwelt nach Maßgabe ihrer „Interessen“ und Lebensgewohnheiten (man denke z.B. an die Burgen des Bibers oder an Termitenhügel, die die vorhandene Landschaft stark verändern und prägen können; oder auch an Korallenriffe und Guanovogelkolonien), aber unterhalb der Primatenstufe vollziehen sich alle diese Aktivitäten auf der Grundlage eines angeborenen Instinktprogramms, denn die nicht-humanen Lebewesen können gar nicht anders, als sich so oder so zu verhalten. Weshalb man zu Recht ein bloß instinktives oder reflexartig-reaktives Verhalten vom menschlichen Handeln zu unterscheiden pflegt: denn erst das Handeln erfolgt absichtsvoll und gezielt, wobei in der Regel auch Handlungsalternativen bestehen, zwischen denen eine „freie Wahl“ getroffen wird. Offenbar ist nur der Mensch dazu imstande, im vollen Sinne zweckgerichtet und begründet zu handeln, indem er Prioritäten setzt und mit Hilfe seiner Vorstellungskraft Pläne schmiedet. Hieraus entspringt denn auch die besondere Verantwortlichkeit des Menschen für seine Taten bzw. Unterlassungen: Nur vom Menschen kann man eine Rechtfertigung für seine Handlungen einfordern. Zwar können auch höhere „intelligente“ Tiere gelegentlich „tricksen“, indem sie ihre Artgenossen z.B. über die Lage einer versteckten Beute offenbar bewusst täuschen, doch wir würden sie deshalb nicht zur Rechenschaft ziehen oder ihnen eine Schuld zuweisen. Erst vom Menschen könnte man hier ein „schlechtes Gewissen“ erwarten, weil oder falls er dabei gegen eine bestehende moralische oder rechtliche Norm verstoßen hat. Mancher wird vielleicht entgegnen, dass sein Hund sehr wohl weiß, wenn er etwas „Schlechtes“ getan hat. Doch es ist wohl eher so, dass der Hund bloß merkt, dass sein Halter über ihn verärgert ist und er daher dessen Zorn fürchten muss. – Doch dass allein der Mensch ein „sittliches“, nämlich verantwortliches Wesen ist, bedeutet nicht, dass anderen Lebewesen keinerlei „ethischer Wert“ zugebilligt zu werden braucht: dass z.B. ein Fuchs sich nicht an einem „Hühnerdiebstahl“ schuldig machen kann, rechtfertigt nicht, dass der Mensch ihn wie irgendeine „Sache“ behandeln darf, da der Fuchs ein empfindungsfähiges Wesen ist, dass zu leiden vermag, sodass hier für den Menschen ein Verbot der Leidzufügung besteht. Der Mensch darf zwar seinen Hühnerbesitz gegen den Fuchs verteidigen, aber ohne dem Tier hierbei vermeidbares Leid zuzufügen. Vor allem aber ist auch einem Raubtier ein unbedingtes Lebensrecht zuzugestehen, da auch dieses über einen moralisch relevanten „intrinsischen Lebenswert“ verfügt. Der Tierschutz dient nicht nur der Arterhaltung, sondern pocht auch auf das Wohlergehen jedes einzelnen Individuums jeder empfindungsfähigen Tierart. Die Erhaltung der Biodiversität auf diesem Planeten sollte daher nicht nur aus Eigeninteresse, sondern auch aus ethischem Respekt vor allem Lebendigen geschehen. Naturschutz ist insofern auch eine „ethische Pflicht“. (Nähere Erläuterungen hierzu findet der Leser in Paslack 2012, S. 65 ff.)
*2*Umweltpolitiker bewegen sich daher auf einem Terrain, das sie vor ungewohnte Aufgaben stellt, denn mit der Natur gibt es zwar einen Austausch, aber keinen Dialog. Und der Mensch kann zwar um sein Leben kämpfen (etwa im Faslle eines Erdbebens oder einer Flutkatastrophe), aber nicht gegen die Natur kämpfen, denn die natur selbst ist weder gegen noch für den Menschen, sondern geschieht einfach. Sie kennt auch keine „Katastrophen“, sondern nur Umstrukturierungen geringeren oder größeren Ausmaßes. Was wir von der Natur lernen können, sind daher keine Regeln für unser Zusammenleben, sondern lediglich Musterlösungen für technische Fragestellungen hinsichtlich Machbarkeit, Wirksamkeit und Effizienz. Und schließlich können wir von der Natur auch etwas über die biologischen Grundlagen unserer eigenen Gattung erfahren: z.B. über jene „archaischen“ psychischen Mechanismen, die unsere spontanen Verhaltensreaktionen (Reflexe) prägen und steuern. Vor allem aber kann uns unser Naturwissen dazu verhelfen, jene Naturgegebenheiten und Naturprozesse nicht zu schädigen oder zu stören, die für unser Überleben unentbehrlich sind.
6.1.2. Basiseigenschaften komplexer dynamischer Systeme
Die nachstehende Darstellung geht hauptsächlich deshalb ins Detail, weil es ihre Absicht ist, den Leser für das „systemische Denken“ zu sensibilisieren. Der Leser soll mit den Grundbegriffen, aber auch mit den Tücken und Schwierigkeiten ihrer Anwendung vertraut gemacht werden. Es werden daher nur einige wenige Vorkenntnisse vorausgesetzt. Nach und nach soll deutlich werden, was es heißt, die Wirklichkeit als ein System bzw. als ein Geflecht aus vielen (Sub-) Systemen zu betrachten. Bekanntlich kann es leicht passieren, dass man „den Wald vor lauter Bäumen“ nicht sieht. Bei der Systemanalyse kommt es aber gerade auf den „Wald“ an, denn Waldbäume verhalten sich anders als einzeln stehende Bäume. Wobei es aber gar nicht stimmt, dass irgendein Baum jemals allein dastehen würde: denn immer ist ein wasser- und bakterienreicher Boden da, auf dem er steht, und stets sind eine oft mit Wolken überzogene Atmosphäre sowie eine Licht spendende Sonne vorhanden, mit denen jeder Baum in Wechselwirkung steht (auch wenn der Baum natürlich nicht auf die weit entfernte Sonne selbst zurückwirken, sondern deren Lichtenergie für seinen Stoffwechsel bloß photosynthetisch nutzen kann).
Ganz allgemein kann man „Systeme“ als geregelte Gefügegesamtheiten aus mehr oder minder vielen Komponenten definieren, bei denen die Relationen zwischen den Komponenten wichtiger sind als die Komponenten selbst. In diesem Buch geht es allerdings nur um dynamische Systeme (nicht also auch z.B. um Gedankensysteme, nicht um Begriffs- oder Klassifikationssysteme). Und die hier behandelten Systeme sind besonders komplex, d.h. auf vielfältige Weise intern vernetzt, indem ihre Komponenten auf unterschiedliche Weise miteinander wechselwirken oder „kommunizieren“. Auch sind hier die Komponenten keineswegs alle gleichartig, sondern oft sogar höchst verschiedenartig. Thematisiert werden hier also nur solche Systeme, die einen ganzheitlichen Struktur-Prozess-Zusammenhang bilden. Zudem sind die hier betrachteten Systeme sämtlich selbstorganisiert und selbsterhaltend, also nicht geplant oder „konstruiert“ wie etwa Maschinen. Und überdies sind sie evolutionsfähig, indem sie ihre Binnenstrukturen, ihre Operationsregeln und auch ihre Größe (ihre räumliche Ausdehnung, aber auch ihre zeitliche Dauer) durchaus ändern können. Hinzu kommt schließlich noch, dass die hier interessierenden Systeme (jedenfalls weitgehend) „funktionell geschlossen“ sind, was ihre Ordnung stabilisiert und wodurch sie in einem gewissen Maße widerstandsfähig gegenüber Störungen aus ihrer Umwelt werden. Die Systeme, mit denen wir uns in dem vorliegenden Buch befassen, sind wahrscheinlich sogar die komplexesten dynamischen Systeme, die wir überhaupt kennen. Entsprechend anspruchsvoll und schwierig ist es, diese Systeme theoretisch zu verstehen und in der Praxis erfolgreich zu managen.
Wenn nun von einem „sozial-ökologischen System“ (SES) die Rede ist*3*, dann haben wir es hier offenbar mit einem extrem komplexen dynamischen System zu tun – oder genauer: mit einem ganzen Geflecht von verschiedenen Systemen, die allesamt ineinandergreifen und deren jeweils interne und interdependente Wechselwirkungen zu Ergebnissen führen, die nicht oder nur in Grenzen vorhersehbar sind. Zumal wir es nicht gewohnt sind, in komplexen („kreiskausalen“ und nicht-linearen) Prozessabläufen zu denken und zudem die immensen Datenmengen zu berücksichtigen, die bei der Beobachtung dieser Vorgänge anfallen: sofern wir diese Daten überhaupt haben, denn sie müssen ja erst mühsam und auf einem methodisch zuverlässigen Wege gewonnen werden. Und selbst dann, wenn wir alle erdenklichen empirischen Daten zur Verfügung hätten, auch dann müssten wir erst noch herausfinden, welche von ihnen und in welcher Hinsicht wichtig sind. Hierzu gehört auch, dass wir die richtigen Fragen stellen und über das methodische (vor allem mathematische) Rüstzeug verfügen, mit dessen Hilfe wir das Datenmaterial angemessen ordnen und auswerten können. Kurzum: Um einen Aussagewert zu erhalten, müssen wir die erhobenen Daten auch interpretieren können, denn erst hierdurch werden sie informativ und wissenswert. Und es versteht sich von selbst, dass die Erstellung eines umfassenden Modells nur interdisziplinär, also nur durch das Zusammenwirken zahlreicher sozial-, kultur- und naturwissenschaftlicher Disziplinen erreicht werden kann. Eine einzelne akademische Disziplin wäre hier schlicht überfordert.
Im Folgenden werden zunächst die essenziellen Merkmale von komplexen und dynamischen Systemen überhaupt beschrieben. *4*Denn diese Eigenschaften sind auch für das weiter unten behandelte „sozial-ökologische System“ von zentraler Bedeutung.
*3*Im deutschen Sprachraum ist auch der Ausdruck „sozio-ökologisches System“ gebräuchlich (in Analogie zu den Beschreibungen sozio-kultureller, sozio-ökonomischer oder sozio-technischer Systeme). Statt im Singular nur von einem einzigen „sozial-ökologischen System“ kann man auch im Plural von vielen „sozial-ökologischen Systemen“ sprechen, wenn man bestimmte „ökologische Komplexe“ (oder systemische Einheiten) aus dem „Ökosystem Erde“ herausgreift und für die Analyse thematisiert. So gibt es neben zahllosen lokalen auch viele regionale Ökosysteme, die alle zusammen das globale Ökosystem unseres Planeten ausmachen. Auf das methodische Problem, wie sich einzelne sozial-ökologische Systeme „zuschneiden“ bzw. voneinander separieren lassen, werden wir weiter unten noch zu sprechen kommen.
*4*Die Darstellung der Basiseigenschaften komplexer dynamischer Systeme beruht im Wesentlichen auf Vorarbeiten eines der beiden Autoren dieses Kapitels: siehe vor allem Paslack (1991), Paslack (2012) und insbesondere Paslack (2019).
6.1.2.1. Selbstorganisation, „Umweltoffenheit“ und „operationale Geschlossenheit“ .
Systeme vom gesellschaftlichen und ökologischen Typ organisieren sich im Wesentlichen selbst, worauf bereits in der Einleitung (7.1.1.) hingewiesen wurde. Damit ist gemeint, dass solche Systeme sowohl ihre internen Strukturen selbst aufbauen als auch selbst (autonom) die Regeln festlegen, nach denen dieser Strukturaufbau und dessen Reproduktion (Strukturerhaltung) erfolgt. Im Unterschied zu „trivialen“ Maschinen (etwa Automaten) gibt es hier keinen Konstrukteur, der von außen her den Aufbau und das Prozessieren (Funktionieren) des Systems bestimmt, aber auch keine innere Zentralinstanz, die diese „Selbsterzeugung“ und Selbstregulation steuern würde, sondern stattdessen ein komplexes Zusammenspiel aller Systemelemente oder Strukturkomponenten, aus dem Form und Funktionsweise des Systems spontan (d.h. ungerichtet und ungeplant) „emergieren“ – was jedoch zumeist nicht auf einmal, sondern über zahlreiche Schritte hinweg (evolutionär) geschieht. Und natürlich kann dieser Vorgang immer nur im Rahmen der geltenden Naturgesetze stattfinden, wobei (wie wir noch sehen werden) die „Beherrschung“ der Gesetze der Thermodynamik eine besondere Rolle spielt. Damit aber solche Systeme ihre Struktur und ihr Verhalten zum einen selbst determinieren und zum andern sich auch fortentwickeln können, indem sie sich fortwährend an geänderte Umweltbedingungen anpassen, müssen sie „evolutionär offen“ sein. Hierzu wiederum dürfen die einzelnen Systemelemente nicht zu „starr“ (unelastisch) beschaffen sein, sodass sich im Geflecht ihrer Wechselwirkungen „evolutionäre Spielräume“ auftun können. Wir haben es hier also auch mit „selbstadaptiven Systemen“ zu tun.*5*
Wenn man von einem „System“ spricht, dann muss man auch von der „Umwelt“ sprechen, da beide Begriffe ein Paar bilden: und zwar von seiner Umwelt, denn komplexe (etwa lebende) Systeme befinden sich nicht einfach nur in einer „Umgebung“, sondern unterhalten mit dieser ganz spezifische Austauschbeziehungen, was zur Folge hat, dass nicht alles, was „draußen“ geschieht, für ein bestimmtes System (zumindest nicht unmittelbar) relevant ist: Nur das, was das System für seinen Erhalt „braucht“, wird aus dem Umgebung seligiert. Dies bedeutet, dass ein derartiges System sich auf eine jeweils besondere Weise „sensibel“ (rezeptiv und reaktiv) gegenüber einem bestimmten „Ausschnitt“ der Gesamtwirklichkeit verhält: und dieser „Ausschnitt“ bildet dann die „Umwelt“ des Systems. So „interessieren“ sich etwa die sozialen Humansysteme mit ihren verschiedenen Subsystemen (wie Wirtschaft, Recht und Kultur) in der Regel nur für spezielle Aspekte ihrer Umgebung: so sind z.B. für das ökonomische Subsystem der Gesellschaft vor allem solche Objekte in der Natur (Lagerstätten, Wasservorkommen, züchtbare Lebewesen usw.) von Interesse, die sich wirtschaftlich verwerten lassen (und mit denen sich Geld verdienen lässt).
Dieser „selektive Zugriff“ auf die Umgebung, der dem System seine spezielle Umwelt verschafft, ist nun zwar aus der Sicht des Systems sinnvoll und verständlich, doch ist damit die Gesamtwirklichkeit keineswegs verschwunden, sondern nur aufgrund einer bestimmten „systemischen Perspektive“ ausgeblendet, d.h. in den allgemeinen „Welthintergrund“ (Seinshorizont) abgedrängt worden. Denn was hier stattfindet, ist ja lediglich eine jeweils systembezogene „Reduktion von Weltkomplexität“ (wie der deutsche Soziologe Niklas Luhmann dies genannt hat), die das System für seine eigenen Zwecke vollzogen hat, um nicht auf alles zugleich achten, d.h. immerzu die gesamte Vielfalt des Seienden „intrasystemisch verarbeiten“ zu müssen, was zwangsläufig zu einer operativen Überlastung des Systems führen würde. Diese selektive Einschränkung des „Blicks“ ist aber nicht frei von gewissen Risiken, da sie auch leicht „blind“ machen kann für Vorgänge in seiner Umgebung, die für seinen Fortbestand und sein Wohlergehen durchaus von erheblicher Relevanz sein können! Und eben in dieser Situation befindet sich momentan die Menschheit, die allzu lange auf Kosten der Natur gewirtschaftet hat und nunmehr feststellen muss, dass ihre Eingriffe in die Natur dort einerseits zu Kontaminationen und Degradationen und andererseits (damit zusammenhängend) zu kumulativen Entwicklungen (wie etwa einer „kritischen“ Anreicherung von Kohlenstoff in der Atmosphäre und steigenden Temperaturen) geführt haben. Diese Entwicklungen konnten auch deshalb für eine gewisse Weile leicht übersehen werden, weil sie außerhalb des Fokus von Wirtschaft, Siedlungsplanung, Wasserregulierung und Verkehrsaufkommen lagen.
Zwar hat man schon immer darauf geachtet, dass „kleinräumig“ und „mittelfristig“ (also bezogen auf das gerade anstehende Planungsvorhaben) die vorhandenen Naturressourcen möglichst sinnvoll und effizient genutzt werden, aber die komplexeren, nämlich „weiträumigen“ und „langfristigen“ Rückkopplungseffekte innerhalb des eigendynamischen Naturhaushaltes konnte oder wollte man nicht berücksichtigen. In der Psychologie würde man hier wohl von einer gewissen „Betriebsblindheit“ oder Kurzsichtigkeit sprechen. Aber nach wie vor ist die Natur mit ihrem riesigen Gewebe aus miteinander wechselwirkenden Ökosystemen zur Gänze da! Wenn also die Natur auch in Zukunft eine für uns lebensfähige Umwelt bilden soll, dann müssen wir einen Weg finden, um die „hausgemachten“ (humansystemischen) Beschränkungen unserer Umweltwahrnehmung zumindest so weit zu überwinden, wie es für die Zukunftsfähigkeit der Menschheit erforderlich ist. Dies ist nicht zuletzt auch ein Gebot der Generationengerechtigkeit, insofern auch unsere ferneren Nachkommen ein Anrecht auf eine Lebenswelt haben, die ihnen ein erträgliches, ja angenehmes Leben im Austausch mit einer möglichst intakten Natur gestattet.
Wie aber könnten wir, trotz unserer „systemischen Brille“, diese erweiterte „Umweltoffenheit“ zur Natur hin erreichen? Zum Glück gibt es unter den Subsystemen der modernen Gesellschaft ein besonderes „Funktionssystem“, das inzwischen sehr stark ausdifferenziert ist und über Erkenntnisreserven verfügt, die uns über den „Tellerrand“ unserer vorwiegend ökonomischen Interessen an der Nutzbarmachung der Natur hinausblicken lassen: die Wissenschaft. Obzwar nun auch die Wissenschaft (wie jedes andere funktionsspezifisches Sozialsystem) an ganz bestimmte „Funktionsimperative“ (Wissen und Erkenntnis) und „methodische Standards“ (z.B. experimentelle Regeln und statistische Relevanzkriterien) sowie an „diskursive Ideale“ (nur das beste rationale Argument zählt) gebunden ist, ist sie gleichwohl prinzipiell dazu in der Lage, alles dem Menschen mögliche Wissen über die Natur zu gewinnen und für andere gesellschaftliche Zwecke zur Verfügung zu stellen. Hierzu aber muss die Gesellschaft sich konsequent als eine „Wissensgesellschaft“ ausrichten, die alle ihre geplanten oder auch unbeabsichtigten Wechselwirkungen mit der Natur einer rationalen Prüfung nach wissenschaftlichen Kriterien unterzieht. Und hierbei kämen keinesfalls nur die Erkenntnisse der Naturwissenschaften zur Sprache, sondern müssten auch die Methoden und Wissensbestände der Sozial- und Kulturwissenschaften miteinbezogen werden, da ja die menschlichen Interessen an der Nutzung der Natur weiterhin bestehen bleiben sollen. Alle relevanten Wissenschaftsdisziplinen, auch z.B. die Ingenieurwissenschaften oder die Psychologie und die Medizin, müssen somit daran beteiligt werden, ein umfassendes und praktikables Modell für die Prozesse in sozial-ökologischen Systemen zu erarbeiten.
Bei all dem sollten auch die ästhetischen Aspekte unseres Naturerlebens nicht übergangen werden, die sich nicht so einfach in ein wissenschaftliches Modell einfügen lassen, jedoch unser allgemeines Naturverhältnis wesentlich mitprägen: eine intakte Natur, das ist immer auch eine „schöne Natur“, in der wir uns wohl fühlen und neue Kräfte sammeln können. Also auch dieses ästhetische und seelische Interesse an der Natur ist zu berücksichtigen, wenn wir Maßnahmen zur Umweltpflege und zum Naturschutz ergreifen. Die Schonung natürlicher Ressourcen und Landschaften sowie die Bewahrung der Artenvielfalt muss daher immer auch die ästhetischen (und vielleicht sogar die spirituellen) Bedürfnisse des Menschen einschließen, denn als Kulturwesen betreiben wir nicht nur Wirtschaft, Wissenschaft und Ingenieurskunst.*6*
Wenn wir nun den Aspekt der „Umweltoffenheit“ komplexer Systeme mit dem Aspekt ihrer Selbstorganisation und internen Selbstregulation (nach autonomen Regeln) zusammenfassen, dann ergibt sich folgendes Bild: Alle sozialen und ökologischen Systeme werden zwar einerseits von jeweils eigenen Regeln beherrscht werden, weshalb sie als „operational geschlossene Systeme“ aufgefasst werden können, aber andererseits stellen sie zugleich auch „offene Systeme“ dar, insofern sie Energie und Materie aufnehmen sowie wieder abgeben: so bezieht das soziale System fortlaufend Rohstoffe für die Ernährung und Produktion aus dem ökologischen System, um sie intern zu verarbeiten oder zu konsumieren, gibt diese aber irgendwann an die Natur und deren Stoffkreisläufe zurück – sei es in Form von Abwärme oder materiellem Müll. Man sagt dann auch, dass das soziale System sich von all dem entlastet, was es nicht mehr braucht und das bei seinem Verbleiben die innere Ordnung des Sozialsystems sogar stören könnte: physikalisch gesehen handelt es sich hierbei um einen Export (oder eine Externalisierung) von „Entropie“, also von „Unordnung“.*7* Und naürlich bilden auch Ökosysteme (so wie bereits die einzelnen Lebewesen) „offene Systeme“, die mit ihrer Umwelt Materie und Energie austauschen. Es ist somit ein Kennzeichen von operational geschlossenen und zugleich energetisch und materiell offenen Systemen, dass sie ihre interne Ordnung nur dadurch aufbauen, stabilisieren und erhalten können, dass sie einerseits ihrer Umwelt selektiv das entnehmen, was sie zu ihrem Weiterleben benötigen, und andererseits alles das wieder an die Umwelt zurückgeben, was ihre inneren Funktionen beeinträchtigen könnte.
*5*Der Ausdruck „selbst“ verweist hier übrigens nicht auf irgendein ominöses „Selbst“, auf das hin alle Prozesse bezogen sind (so wie wir das im Falle der Psyche annehmen, insofern hier zumindest alle bewussten Vorgänge auf ein „Ich-Selbst“ referieren); vielmehr bedeutet das „selbst“ in einem Term wie „selbstorganisiert“ nur so viel wie „spontan“ oder „von selbst“ sich ereignend.
*6* In der Religion und in den bildenden Künsten (aber auch in der Dichtung) hat das Verhältnis des Menschen zur Natur schon immer eine große Bedeutung gehabt: Doch während die Kunst fast immer (von der Antike angefangen) die Schönheiten der Natur geradezu gefeiert und sich zeitweise die Natur sogar zum Vorbild genommen hat, haben vor allem die Hochreligionen (Judentum, Christentum und Islam) der Natur oft einen eher zweifelhaften Wert beigemessen (was oft auch die geringe Wertschätzung des menschlichen Leibes und die „sündhafte“ Sexualität einschloss): etwa wenn in der Bibel davon die Rede ist, dass sich der Mensch die Natur „untertan“ machen solle – ein Imperativ, dem die moderne technologische Zivilisation nur allzu gern gefolgt ist. Doch gibt es hier auch Hinweise, die Natur wie ein „guter Hirte“ zu hegen und zu pflegen, da auch sie (neben Seele und Geist) eine „Schöpfung“ Gottes und daher bewahrenswert sei. Insgesamt ist das Verhältnis der Religion zur Natur (und dies bereits im Mythos) von hoher Ambivalenz geprägt. Demgegenüber haben sich die Künstler aufgrund ihrer eigenen Kreativität oft der schöpferischen Natur verschwistert gefühlt. Aber eben dies machte sie bisweilen auch der Religion verdächtig: wollten die Künstler etwa Gott „ebenbürtig“, d.h. selbst göttlich werden? Ein Vorwurf, den viele Theologen und Gläubige aber auch gegenüber der Forschung und Technik erhoben haben. Dieser „Hybris“-Vorwurf betraf früher vor allem Bestrebungen, „Leben zu erschaffen“ (wie etwa den Golem oder das Frankenstein-Monster). In der Gegenwart richtet sich der Argwohn eher gegen bestimmte KI-Entwicklungen, die Gentechnik, die mögliche Erzeugung von Cyborgs (Mensch-Maschine-Hybriden) und die „synthetische Biologie“ – gerade weil Leben und Geist göttliche Hervorbringungen seien, die nicht künstlich simuliert oder manipuliert werden dürften. Denn heute ist es eher so, dass die Religion den Wert der Natur – und einer auch spirituellen Verbundenheit mit ihr – eher hochschätzt (vorausgesetzt, dass diese Naturverbundenheit nicht in esoterische Gefilde abdriftet). Und schon immer hat es in allen Religionen auch einen naturmystischen Nebenzweig oder Unterstrom gegeben, der das „Buch der Natur“ auf kontemplative Weise als einen Offenbarungstext zu lesen versuchte. Auch gab es seit jeher Pantheisten, die auf die Identität (Wesensgleichheit) von Natur und Gott bestanden haben (etwa Giordano Bruno oder Spinoza). Jedenfalls finden sich in Kunst, Religion und Mystik immer wieder Bestrebungen, die Einheit von (göttlichem) Geist und Natur zu betonen und zu beschwören – und damit auch die Beziehung des Menschen zur Natur nicht nur als ein ökonomisches oder technisches Verhältnis zu sehen.Thermodynamische Aspekte (wie etwas das Wirken der Entropie) spielen daher auch in einigen SES-Ansätzen eine wesentliche Rolle. So arbeitet z.B. das SOHO-Konzept von Kay und Boyle (2008) explizit mit Begriffen wie „energetische Dissipation“, „Nichtgleichgewicht“ und „exergy“ (womit die Qualität der verfügbaren Energie gemeint ist): „The proponents of the [SOHO-] framework argue that as systems move further from equilibrium, exergy increases, more dissipative opportunities become available, and more organization emerges. Flows from ecosystems provide exergy both supporting and constraining human society.” Das Fließen von strukturell verwertbarer Energie in Systemen fernab vom Gleichgewicht ermöglicht sogar erst die (innovative) Selbstorganisation dieser Systeme. Dieses systemtheoretische Wissen enthebt freilich nicht von der Notwendigkeit, die selbstorganisativen Strukturveränderungen in jedem einzelnen konkreten System empirisch aufzuzeigen. Denn jedes System verfügt über seine jeweils eigenen (spezifischen) „inneren Randbedingungen“, unter denen es operiert und evolviert. „Resilience can be described as the ability of a system to maintain its identity“ (Cumming/Collier 2005). Solange also ein System in der Lage ist, größeren Störungen ausreichend „Widerstandskraft” entgegenzusetzen, solange erhält es seine Identität, sodass es wiedererkennbar bleibt. Ausdrücke wie „risikoreich“ oder „gelingen“ sind im Falle natürlicher Prozesse immer nur metaphorisch zu verstehen, denn die Natur kennt weder Riskiken noch Erfolg oder Misserfolg, da sie über keinerlei Selbstbewusstsein oder Intentionalität verfügt. Es ist jedoch äußerst schwierig, beim Reden über die Natur solche „anthropomorphen“ Metaphern gänzlich zu vermeiden.
*7*Thermodynamische Aspekte (wie etwas das Wirken der Entropie) spielen daher auch in einigen SES-Ansätzen eine wesentliche Rolle. So arbeitet z.B. das SOHO-Konzept von Kay und Boyle (2008) explizit mit Begriffen wie „energetische Dissipation“, „Nichtgleichgewicht“ und „exergy“ (womit die Qualität der verfügbaren Energie gemeint ist): „The proponents of the [SOHO-] framework argue that as systems move further from equilibrium, exergy increases, more dissipative opportunities become available, and more organization emerges. Flows from ecosystems provide exergy both supporting and constraining human society.” Das Fließen von strukturell verwertbarer Energie in Systemen fernab vom Gleichgewicht ermöglicht sogar erst die (innovative) Selbstorganisation dieser Systeme. Dieses systemtheoretische Wissen enthebt freilich nicht von der Notwendigkeit, die selbstorganisativen Strukturveränderungen in jedem einzelnen konkreten System empirisch aufzuzeigen. Denn jedes System verfügt über seine jeweils eigenen (spezifischen) „inneren Randbedingungen“, unter denen es operiert und evolviert.
6.1.2.2. Resilienz und Robustheit
Doch soziale Systeme vermögen sich in Grenzen auch neuen Herausforderungen seitens der natürlichen Umwelt anzupassen, indem sie ihre vorhandenen Ressourcen anders verteilen und nutzen oder benötigte Umweltressourcen, die knapp geworden sind, teilweise ersetzen (substituieren); ja, sie können bisweilen sogar ihre eigenen Regeln und Prioritäten ändern, sich selbst weiterentwickeln oder ihre internen Prozesse umstrukturieren. Mit anderen Worten: Soziale Systeme erweisen sich in ihrem Verhalten oft als überraschend flexibel, wenn Knappheiten oder Turbulenzen in ihrer Umwelt auftreten, die sie in Schwierigkeiten bringen oder sogar ihren Bestand bedrohen. Dies macht ihre Resilienz oder Widerstandsfähigkeit in prekären Situationen aus.
Flexibel und in Grenzen resilient sind aber auch die ökologischen Systeme, in denen es ebenfalls zu Umstrukturierungen kommen kann, die vielleicht mit dem Tod vieler Individuen einer Spezies oder sogar mit dem Aussterben ganzer Arten einhergehen, aber nicht in einer völligen Zerstörung des Systems einmünden müssen.*8* Hierbei spielen dann aber nicht Entscheidungen über Prioritäten und Maßnahmen, wie im Falle sozialer Humansysteme, eine Rolle, sondern vor allem Prozesse der Größenreduktion von Populationen oder einer Neudurchmischung der in ihnen beheimateten Arten sowie das zufällige Auftreten von günstigen genetischen Mutationen, die einigen Spezies einen Selektionsvorteil gegenüber Konkurrenten verschaffen. Gleichwohl sind solche Transformationsprozesse in allen offenen Systemen immer risikoreich, sodass es ihnen unter Umständen nicht gelingt, sich trotz aller Anpassungsbemühungen am Leben zu erhalten.*9*Sollte z.B. die Menschheit, die ja nicht nur in ihren selbst erschaffenen Sozial- und Kultursystemen lebt, sondern als biologische Art zugleich auch der Ökologie der Erde zuzurechnen ist, aussterben, dann wird die Natur natürlich trotzdem weiterbestehen (allein schon in geologischer Hinsicht): nur dass dann die biologische Evolution ohne uns ihren Fortgang nehmen würde. Um dies zu verhindern, eben darum ist es so wichtig, die sozial-ökologischen Wechselwirkungen immer besser zu verstehen und damit auch unsere Chancen für eine erfolgreiche Anpassung an eine gewandelte Umwelt zu erhöhen. Und am besten ist es natürlich, wenn die ökonomischen und sozialen Kosten für eine solche Anpassung möglichst gering ausfallen würden bzw. wenn es erst gar nicht zu gravierenden Umweltveränderungen (wie etwa einen größeren Klimawandel) kommen würde.
Die adaptive Resilienz biologischer bzw. ökologischer Systeme geht oft mit einer Robustheit einher, worunter die evolutionäre Beständigkeit einer bestimmten Eigenschaft des Systems im Falle von Störungen oder unter Bedingungen der Unsicherheit zu verstehen ist. Je robuster ein System gegenüber externen Störungen ist, desto mehr vermag es seine ursprüngliche Identität zu bewahren. Für die Analyse von SES und insbesondere für die Vorhersagbarkeit ihres Verhaltens ist die Identifizierung der „robusten Faktoren“ von entscheidender Bedeutung, da sie den Spielraum möglicher Variabilität einschränken.
Damit ist denn auch das wesentliche Ziel sozial-ökologischer Modellbildungen umrissen: nämlich sich abzeichnende größere Umweltprobleme möglichst frühzeitig zu erkennen und ihre Tragweite abzuschätzen (Monitoring und Warnfunktion), deren Ursachen aufzuzeigen (Kausalanalyse und Erklärungsfunktion) sowie Hinweise auf eine effiziente Gegensteuerung liefern zu können (Empfehlungsfunktion). Freilich ist es auch unter Wissenschaftlern nicht immer klar, welche Maßnahmen denn nun die geeignetsten sind, sodass es hier nicht selten zu grundsätzlichen Kontroversen über das richtige Vorgehen kommt: Ist es z.B. sinnvoller, gefährdeten Wäldern daurch zu „helfen“, dass man in ihnen „aufräumt“ und sie mit klimarobusteren Bäumen aus anderen Weltgegenden aufforstet, oder wäre es besser, die Wälder einfach für eine Weile in Ruhe zu lassen, sodass sie sich durch ihre Selbstorganisation von selbst erholen und an geänderte Klimabedingungen anpassen können? Die verschiedenen sozial-ökologischen Modelle geben auf diese und ähnliche Fragen durchaus unterschiedliche Antworten, je nachdem, von welchen Prämissen sie jeweils ausgehen.
Um all dies leisten zu können, ist eine besondere Denkweise erforderlich: das „systemische Denken“, d.h. ein Denken im Hinblick auf ein Verständnis der Wechselwirkungen zwischen rekursiv miteinander vernetzten Komponenten, die zusammen ein „Ganzes“ bilden, in dem gewissermaßen alles mit allem zusammenhängt. „Systemisches Denken“ versteht sich jedoch nicht von selbst, sondern muss erlernt und eingeübt werden. Dies ist alles andere als einfach, denn im Allgemeinen denken wir „linear“, d.h. in einfachen Kausalketten, die sich in verschiedene Richtungen immer weiter entwickeln und baumartig verzweigen. Hierbei verlieren wir rasch die Übersicht. „Nicht-lineare“ oder rückkoppelnde „kreiskausale“ Zusammenhänge, wie sie für komplex vernetzte Systeme typisch sind, entziehen sich in der Regel unserem Verständnis, zumal wir im Alltag zumeist mit einfachen Ursache-Wirkungs-Beziehungen zu Recht kommen. Dies gilt aber auch schon für exponentielle Wachstumsprozesse, bei denen sich in einem bestimmten Zeitraum die Quantität eines bestimmten Faktors verdoppelt (daher fällt es vielen Menschen schwer, die exponentielle Entwicklungsrate einer Pandemie, wie etwa der von Covid 19, nachzuvollziehen). Zudem sind wir es gewohnt, kurzfristig zu denken und zu planen, weshalb uns die Langzeitfolgen unserer Handlungen zumeist verborgen bleiben. Das Alltagsdenken, aber auch das Denken vieler Politiker und Unternehmensführer, findet überwiegend auf kleinen zeitlichen und räumlichen Skalen statt, sodass weitreichende (zumal globale) Folgewirkungen kaum einmal berücksichtigt werden. In gewisser Weise verhalten wir uns fast immer opportunistisch (indem wir dem nächstliegenden Vorteil den Vorzug geben) und „zukunftsblind“, wenn es um Entwicklungen jenseits unseres kurz- oder mittelfristigen Handlungshorizonts geht („in the long run“). In einer stark vernetzten und zugleich „systemisch geschlossenen“ Welt wie der unsrigen kann sich ein solches Denken jedoch leicht „rächen“, indem wir plötzlich mit unerwarteten und vielleicht sogar irreversiblen Folgen unseres Handelns (insbesondere bei tiefen Eingriffen in den Naturhaushalt) konfrontiert werden.
*8*„Resilience can be described as the ability of a system to maintain its identity“ (Cumming/Collier 2005). Solange also ein System in der Lage ist, größeren Störungen ausreichend „Widerstandskraft” entgegenzusetzen, solange erhält es seine Identität, sodass es wiedererkennbar bleibt.
*9*Ausdrücke wie „risikoreich“ oder „gelingen“ sind im Falle natürlicher Prozesse immer nur metaphorisch zu verstehen, denn die Natur kennt weder Riskiken noch Erfolg oder Misserfolg, da sie über keinerlei Selbstbewusstsein oder Intentionalität verfügt. Es ist jedoch äußerst schwierig, beim Reden über die Natur solche „anthropomorphen“ Metaphern gänzlich zu vermeiden.
6.1.2.3. Beschränkte Vorhersagbarkeit von komplexen Systemprozessen
Eben deshalb ist es erforderlich, dass wir lernen, mit Komplexität, Exponentialität, prozessualer Rückkopplung und Nicht-Linearität sowie zirkulärer Kausalität umzugehen. Und glücklicherweise steht uns hierzu eine Reihe von mathematischen Methoden zur Verfügung, mit deren Hilfe sich vernetzte und rekursive Prozesse grundsätzlich modellieren lassen. Gleichwohl sind der Voraussagefähigkeit solcher Prozesse auch bestimmte methodische Grenzen gezogen, gerade weil diese Prozesse derart komplex sind, dass auch unwahrscheinliche Verzweigungen und „feed backs“, ja sogar „chaotische“ oder „fraktale Effekte“ aufgrund unvorhersehbarer Prozessfluktuationen auftreten können. Daher müssen Maßnahmen, die in den Naturhaushalt auf positive Weise eingreifen sollen, immer so designed werden, dass auch eventuelle unerwünschte Effekte, mit denen man nicht gerechnet hat, beherrschbar bleiben, indem sie revidiert werden können („Rückholbarkeit“).
Die relative Unberechenbarkeit des Verlaufs von Systemprozessen bedeutet nun aber nicht, dass in vielen Fällen nicht doch einigermaßen zuverlässige Prognosen und Trendabschätzungen erstellt werden können (zumindest im mittelfristigen Bereich): Je mehr wir an Daten über die Naturprozesse ansammeln und mit geeigneten Modellen und Algorithmen auszuwerten verstehen (i.S. einer „big data-analysis“), desto aussichtreicher wird auch der Erfolg von Maßnahmen, die vorsichtig umgesetzt und von einem möglichst engmaschigen Monitoring begleitet werden. Für eine pessimistische oder „fatalistische“ Einstellung hinsichtlich unserer positiven Steuerungsmöglichkeiten von prekären Entwicklungen in Ökosystemen besteht daher immer weniger Anlass. Als problematisch erweist sich hierbei eher ein immer wieder zu beobachtender Mangel an politischem und administrativem Willen (Governance), die notwendigen Umweltmaßnahmen „sensibel“ und konsequent durchzuführen, da einer solchen Umsetzung oft ökonomische Interessen und Konflikte im Wege stehen. Hinzu kommt, dass Ökosysteme sich nicht an nationale Grenzen halten (man denke nur an das globale Klimasystem) und daher inter- und transnationale Einigungen erforderlich machen, die bisweilen nur unter großen Anstrengungen zustande kommen (wofür die schwierigen Aushandlungsprozesse etwa über eine weltweite Begrenzung der Kohlenstoffemissionen auf den internationalen „Klimagipfeln“ ein beredtes Beispiel liefern).
Im Hinblick auf die grundsätzlich unzureichende Prognostizierbarkeit des künftigen Verhaltens von komplexen Systemen (wozu natürlich auch die sozialen Humansysteme gehören) können wir festhalten: Jede Maßnahme, die in komplexe Systeme interveniert, besitzt immer auch einen gewissen „experimentellen Charakter“, da nun einmal nicht alle möglichen Folgen eindeutig prognostizierbar sind: denn das, was sich an einer Stelle günstig und vorteilhaft auswirkt (etwa bei der Verbesserung des Ertrags einer Feldfrucht), das kann an einen anderen Stelle des ökologischen Systems (etwa beim Klima) mitunter recht negative Folgen zeitigen. Und da es sich hier ja um „Realexperimente“ und nicht um Laborversuche handelt, deren Erfolg grundsätzlich von Kontingenz (Zufallsereignissen) bedroht ist, müssen die Umweltmanager mit der gebotenen Vorsicht und schrittweise vorgehen (sukzessiv und zyklisch), um die „Rückholbarkeit“ der Effekte zu gewährleisten; wozu etwa ein fortlaufendes Monitoring unverzichtbar ist. Komplexe dynamische Systeme sind keine „trivialen Maschinen“, deren Funktionsweise man in und auswendig kennt und technisch relativ leicht beherrschen kann, sondern ihr Verhalten gleicht eher dem von „autopoietischen Lebewesen“ (H. Maturana und F. Varela), wo stets gewisse „Freiheitsgrade“ mitgegeben sind.*10* Was z.B. jeder Obstbauer weiß, wenn er sieht, wie dieselben Obstbäume auf nur geringfügige Änderungen in den Umweltbedingungen oft extrem unterschiedlich reagieren können (z.B. bei leichten Schwankungen in der Umgebungstemperatur oder in der Menge der verwendeten Düngemittel oder je nach der Art des Baumschnitts usw.). Diese „Sensitivität“ von Systemen (seien dies z.B. einzelne Pflanzen oder komplexe Ökosysteme) gegenüber geringen Schwankungen bei wichtigen Parametern ist charakteristisch für das Verhalten von „offenen“ Systemen (auch wenn der berühmte „Schmetterlingseffekt“ nicht gar so oft auftritt, wie man einstmals angenommen hatte).
*10*Unter „Autopoiese“ versteht man die „Selbstherstellung“ und Selbstreproduktion aller physiologischen Prozesse und deren Produkte innerhalb des operational geschlossenen Stoffwechsels eines Lebewesens. Denn lebende Systeme sind stets so organisiert, dass das Ganze des Systems und alle seine Bestandteile sich rekursiv und wechselseitig produzieren und erhalten. Hierbei kommt es gewissermaßen zu einem „produktionalen Kreislauf“ aller biochemischen Komponenten des Organismus, wie man bereits bei einem Einzeller beobachten kann. Natürlich spielen hierbei auch „Regulatoren“ (Gene und andere biochemische „Attraktoren“ und „Ordnungsparameter“) auf verschiedenen Hierarchieebenen eine Rolle (vgl. Matura/Varela 1980).
6.1.2.4. Komplexität, Gleichgewicht und Stabilität
Auf keinen Fall – und auch dies einzusehen fällt dem Alltagsbewusstsein schwer – darf man „Komplexität“ (i.S. einer hochsensiblen Interaktion zwischen den Systemkomponenten) mit „Kompliziertheit“ (der Anzahl der Systemkomponenten) verwechseln: schon ein scheinbar einfaches physikalisches System wie ein Doppelpendel kann sich in seinem Verhalten als überraschend komplex, d.h. höchst variabel erweisen. Und auch in Ökosystemen ist besonders dann, wenn deren Stabilität aus dem Ruder zu laufen droht, die Anzahl der möglichen „Entwicklungspfade“, die diese Systeme evolutiv einschlagen können, manchmal unüberschaubar groß. Doch wiederum darf hier „Stabilität“ nicht mit „Gleichgewicht“ verwechselt werden*11* da sich bei Ökosystemen (aber auch schon bei einzelnen Lebewesen) deren Stabilität allenfalls einem „Fließgleichgewicht“ verdankt: ja, man sagt sogar, dass sie sich (thermodynamisch betrachtet) „fern ab vom Gleichgewicht“ organisieren und stabilisieren, indem sie die Entropie (die Tendenz zur Unordnung) in ihrem Inneren fortlaufend so „umlenken“ (kanalisieren), dass sie das Gegenteil bewirkt: nämlich Strukturen aufzubauen und zu erhalten; der „entropische Energiefluss“ durch das System hindurch wird von dem System nach seinen eigenen Operationsregeln so „gemanagt“, dass die Maximierung der Entropie gerade dadurch zustande kommt, dass der Energiefluss auf seinem Wege fließoptimale Strukturen hervorbringt (so wie die bekannten bienenwabenförmigen Konvektionszellen bei der „Bénard-Konvektion“ in dünnen Flüssigkeitsschichten). Dies wirkt auf den ersten Blick paradox, weil es unserer Alltagsintuition widerspricht, ist aber (physikalisch gesehen) ein vollkommen logischer und kausal determinierter Vorgang.
Anders gesagt: Der stabile Strukturaufbau und das regelmäßige Verhalten selbstorganisierender Systeme unterliegen einer „Ungleichgewichts-Thermodynamik“ (Ilya Prigogine) oder einem „Fließgleichgewicht“ (Ludwig v. Bertalanffy), wobei aber immer auch einmal Phasen der Instabilität auftreten können. Doch gerade diese temporären instabilen Phasen können auch die „Resilienz“ des Systems, seine Widerstands- und Anpassungsfähigkeit gegenüber äußeren Störungen, vergrößern, sodass sie letztlich sogar den „Motor der Evolution“ bilden. Wenn man also immer wieder von einem „Gleichgewicht der Natur“ sprechen hört, dann sollte man eigentlich genauer von einer inhärenten oder intrinsischen „Stabilität natürlicher Ökosysteme“ reden, deren Aufrechterhaltung den Ökosystemen gerade dadurch gelingt, dass sie „fern ab vom (thermodynamischen) Gleichgewicht“ prozessieren. Tatsächlich gleichgewichtige bzw. absolut stabile Systeme (nach dem Vorbild der klassischen Mechanik) wären hingegen zu starr und unflexibel, um sich auf gewandelte Umweltbedingungen adaptiv einstellen zu können, und würden daher leicht zugrunde gehen. Nur dass eben dieser adaptive und evolutionäre Vorteil struktur- und verhaltensflexibler Systeme zugleich auch impliziert, dass ihre Entwicklung bei einer Beeinflussung von außen oft nicht exakt vorhergesehen werden kann – was wiederum für das Umweltmanagement von Nachteil ist.
*11* Derartige Begriffsverwirrungen sind innerhalb der Debatte um das richtige Verhältnis zwischen Ökologie und Ökonomie des Öfteren zu beobachten: So wird z.B. oft von „Nachhaltigkeit“ gesprochen, wo lediglich langwierige oder „zeitlich dauerhafte“ Effekte oder Maßnahmen gemeint sind (in diesem Sinne könnten aber auch Umweltschäden „von Dauer“ sein), während eine „nachhaltige Entwicklung“ sich dadurch auszeichnet, dass eine bestimmte Ressource (z.B. Holz oder Energie) so bewirtschaftet wird, dass sie sich (a) immer wieder erneuern kann (etwa durch das Recycling bereits verwendeter Materialien oder auch durch eine Wiederaufforstung des Waldbestandes, also das Nachwachsen von Waldholz), oder wenn es sich hierbei (b) um die Nutzung einer Ressource handelt, die sich grundsätzlich nicht verbraucht (wie etwa die Solar- oder Windenergie).
6.1.2.5. Dezentralität, Hierarchie und Heterarchie, Emergenz und Skalenunterschiede
Oben sagten wir bereits, dass es in der Natur kein „Steuerzentrum“, keine alle Vorgänge beherrschende Instanz gibt. Eine solche Zentralgewalt gibt es zumindest auch in der modernen demokratischen Gesellschaft nicht: Zwar gibt es die Legislative und die exekutive Regierungsgewalt, gibt es das Gerichtswesen und die Verwaltung, gibt es Polizei und Militär, aber neben diesen politischen und administrativen Institutionen mit ihrer „Gewaltenteilung“ existieren auch noch die Wirtschaftsunternehmen, die im Rahmen der Gesetzgebung relativ autonom agieren, sowie der „freie Markt“ der Güter und Dienstleistungen, den niemand (solange keine Monopole entstehen) zu dominieren vermag und dessen Entwicklung daher oft „chaotisch“ verläuft. Und auch viele kulturelle Einrichtungen (wie Religionen, die Forschung, die Medien und zahlreiche Kunstinstitutionen) führen ein relatives Eigenleben, das zwar oft von staatlichen oder unternehmerischen Finanzierungen abhängig ist, aber dennoch seinen eigenen Regeln und Interessen folgt. Natürlich „beobachten“ und beeinflussen sich alle diese Institutionen und Akteure wechselseitig in einem unablässigen Spiel von „Aktion und Reaktion“, Innovation und Provokation usw., aber insgesamt bilden sie eine „fluide Gemengelage“, innerhalb derer niemand die absolute Kontrolle inne hat oder den maßgeblichen Ton angibt. Doch immerhin gibt es in den demokratisch verfassten Gesellschaftssystemen nicht nur gewisse Spielräume für Selbstorganisation und Selbstregulation, sondern fast überall auch ein erhebliches Maß an „Fremdorganisation“ durch Vorschriften, Normierungen, staatliche Gesetze sowie die öffentliche Moral (die „guten Sitten“), vielleicht sogar eine Art von „Leitkultur“, die sich in vielen Bereichen geltend macht.
Ganz anders in der nicht-humanen Natur: Hier ist alles von vornherein aufgrund evolutionärer Prozesse selbstorganisiert, d.h. völlig bewusst- und planlos allein durch „zufällige“ physikalische und (bio)chemische Wechselwirkungen entstanden. Dies bedeutet aber nicht, dass es nicht auch in der Natur zu ökologischen Ordnungsstrukturen (ja zu „Ordnungsregimes“) gekommen ist, durch welche die Fortsetzung von Evolutionsprozessen in ihren Möglichkeiten erheblich eingeschränkt wird: Der jeweils bereits erreichte „Stand der Entwicklung“ (also das, was schon da ist) beschneidet die möglichen Pfade, auf denen ein Ökosystem sich verändern kann. Diese strukturelle Robustheit oder Widerständigkeit des Ökosystems ist denn auch in Rechnung zu ziehen, wenn der Mensch daran geht, den „Kurs“ des Ökosystems auf eine andere Bahn zu lenken. Allen natürlichen Systemen wohnt ein gewisser „struktureller Konservatismus“ inne, der das Sich-Durchsetzen von Innovationen (von Mutationen oder „evolutionären Schüben“) eher unwahrscheinlich macht (außer vielleicht in „überkritischen“ Situationen, wo das Ganze auf dem Spiele steht). Zur „natürlichen Ordnung“ von Ökosystemen (bzw. der Natur insgesamt) gehören neben „Musterlösungen“ (wie etwa dem Flugapparat der Vögel und Insekten) auch hierarchische Strukturen, also Makroebenen der Ordnung, denen Mikroebenen untergeordnet sind. Dies beginnt bereits beim einzelnen Organismus, der in zahllose Regulationsebenen differenziert ist, wobei das zentrale Nervensystem (etwa der Säugetiere) nur die oberste Spitze dieser hierarchischen Architektur bildet.
Dennoch verbleiben den unteren Ebenen (etwa der Zellebene) stets gewisse „Freiheitsgrade“, insbesondere bei der Verarbeitung von Information (z.B. bezüglich der vorhandenen Wassermenge oder der Mineral- und Energieversorgung), sodass der Stoffwechsel des Lebewesens nicht immer nur „von oben“ her „entschieden“ wird. So könnte es etwa sein, dass das „Dirigat“ der übergeordneten (makrostrukturellen) Muster bei der reaktiven Verarbeitung von ungewöhnlichen Informationen, die eine Art von „Stress“ im Organismus auslösen, in einem gewissen Grade auf die Variabilität lokal wirksamer heterarchischer Strukturen angewiesen ist, um zu einer angemessenen „Antwort“ zu finden. In vielschichtigen Systemen ist immer Vieles möglich.*12* Zu den ungewöhnlichen Informationen, die heterarchisch prozessiert werden können, zählen z.B. solche „negativen“ (lebensbedrohlichen) Informationen, die etwa bei einer mangelhaften Versorgung mit lebenswichtigen Stoffen auftreten, was den Organismus zu „Sparmaßnahmen“ oder internen Umverteilungen zwingt; hierbei kann es sich aber auch um die „Wahrnehmung“ von Schädigungen (etwa durch Parasitenbefall) handeln, auf welche der Organismus ebenfalls flexibel reagieren können muss. Was nun die Bandbreite möglicher Anpassungsreaktionen anbelangt, so dürften hier kaum immer exakte Vorhersagen möglich sein – eben weil die Dominanz eingespielter hierarchischer Reaktionsmuster auch einmal von heterarchischen Prozessen „durchbrochen“ werden kann, sodass sich Wachstum und Verhalten in eine unerwartete Richtung bewegen.
Und mit noch einem einigermaßen rätselhaften Phänomen sieht sich die systemtheoretische Modellbildung konfrontiert: nämlich mit dem der Emergenz. Damit ist gemeint, dass sich die besonderen Eigenschaften von Systemen nicht einfach von den Eigenschaften der Systemkomponenten ableiten lassen. „Emergente Eigenschaften“ treten bereits auf den unteren Stufen der Naturentwicklung zu Tage: so lassen sich z.B. die Fließeigenschaften des Wassers (also einer „lockeren“ Ansammlung vieler Wassermoleküle) nicht aus den Eigenschaften des Wasserstoffs bzw. des Sauerstoffs ableiten.*13* Noch viel mehr gilt dies für komplexe Ökosysteme, die bestimmten Gesetzmäßigkeiten unterliegen, die von keiner der an ihm beteiligten physikalischen, chemischen oder biologischen Komponenten determiniert werden. Hier hilft daher nur die empirische Analyse des konkreten Verhaltens des Ökosystems weiter. Denn nur dann treten die (relativ zu den Komponenteneigenschaften) „supervenienten Merkmale“ des Systems in Erscheinung. Die „emergenten“ Systemeigenschaften sind nicht an den Systemelementen selbst abzulesen, sondern nur an deren Zusammenwirken, also an den Wechselwirkungen zwischen ihnen zu erkennen: sie sind somit Relationseigenschaften (aber wiederum nicht einzelner Relationen, sondern des gesamten Relationengefüges). Zwar setzt eine bestimmte Wechselwirkungsrelation voraus, dass die „Relata“ sich für die Relation eignen (daher wechselwirken z.B. Weidetiere untereinander anders als etwa mit Pflanzen), aber welches Gepräge eine Relation jeweils annimmt, dies hängt von dem Umfeld aller anderen Relationen ab: Wechselwirkungen vollziehen sich somit immer im Kontext aller Umstände und Einflüsse, denen sie ausgesetzt sind, wirken aber auch ihrerseits auf diese Umstände und Einflussfaktoren zurück.
Anders gesagt: Systeme bilden immer Ganzheiten, die „mehr“ und anderes sind als bloß die Gesamtheit ihrer Teile (ihrer Elemente), sodass wir sie aus einer „holistischen Perspektive“ heraus betrachten müssen. Dieses Unterfangen stellt freilich vor gewisse methodische Probleme, insofern eine Analyse immer die „isolierende“ Hervorhebung einer bestimmten Systemvariablen verlangt, um beobachten zu können, wie deren Veränderlichkeit sich auf das Verhalten verschiedener anderer Systemgrößen auswirkt. Erst dann, wenn es gelungen ist, bestimmte „makrostrukturelle“ Mechanismen und Regelmuster innerhalb des Systemkontextes zu eruieren, erst dann lassen sich auch komplexere interne (intrasystemische) und externe (umweltbedingte) Wechselwirkungszusammenhänge quasi „holistisch“ betrachten.
Nun sind die Komponenten eines Ökosystems häufig selbst komplex strukturiert – wie etwa im Falle von Organismen, die ja selbst Systeme verkörpern –, was bedeutet, dass diese Komponenten über ein oft breiteres Spektrum an Verhaltensmöglichkeiten verfügen als man bei ihnen vermuten würde. Aus diesem Spektrum können sich unter der Dominanz der Makroregeln des Systems allerdings stets nur diejenigen Komponenteneigenschaften manifestieren, die das System zulässt bzw. die die Komponenten benötigen, um innerhalb des Ökosystems (bzw. des Ökosystem-Umwelt-Wechselwirkungsgeflechts) überleben zu können: je rigider die System-Umwelt-Bedingungen sind, desto weniger Freiheitsgrade verbleiben den vitalen Komponenten, um ihr Dasein sichern zu können. Der „Überschuss“ an verhaltensmöglicher Eigenkomplexität verschwindet jedoch nicht, sondern bleibt „latent“ erhalten.*14* Wenn nun das Ökosystem als Ganzes in eine „kritische“ Situation geraten sollte, in der seine Stabilität bedroht ist (z.B. beim Erreichen eines „tipping point“ in der Klimaentwicklung), dann kommt es zuweilen zu einer gewissen „Lockerung“ der bislang engen Wechselwirkungsbeziehungen zwischen den Systemkomponenten, sodass sich deren manifester Verhaltensspielraum erhöht (freilich auch der Anpassungsdruck auf sie): nunmehr kann es wichtig werden, dass die Komponenten (Organismen) über Verhaltensreserven verfügen, deren Überlebenswert oder „evolutionäre Fitness“ sie in einem „trial and error“-Prozess austesten können; und auch genetische Mutationen erhalten jetzt verstärkt eine Chance, ihre Vorteilhaftigkeit für das Überleben innerhalb des Ökosystems beweisen zu können. Dies ist denn auch eine jener Stresssituationen, in der „heterarchische Impulse“ die Dominanz der hierarchischen Ökosystemstrukturen partiell oder temporär zu überwinden vermögen: Fluktuationen in der Struktur und im Verhalten der Subsysteme (der Organismen) können unter Umständen sogar zu einer Änderung der Makrostrukturen des Ökosystems führen, indem etwa eine bestimmte Spezies ein bisher nicht mögliches Übergewicht gegenüber den anderen Spezies des Ökosystems gewinnt und dadurch den Charakter des Ökosystems insgesamt verändert.*15*
Bei den „sozial-ökologischen Systemen“ haben wir es nun mit dem Sonderfall zu tun, dass der Mensch sich aufgrund seines Denkvermögens sogar aus eigenen Stücken einen gewissen Freiraum gegenüber den restriktiven Naturbedingungen erobern kann, indem er seinen angeborenen „Überschuss“ an kognitiven Potenzen dazu einsetzt, Technologien zu ersinnen, mit deren Hilfe er seine natürliche Umwelt scheinbar nach Belieben umgestalten oder ausbeuten kann. Dieser kreative Überschuss an Denk- und Handlungsmöglichkeiten des Menschen (z.B. höhere Mathematik treiben zu können) ist zwar nur ein zufälliges Resultat der biologischen Evolution, doch wenn er erst einmal da ist, dann kann er dem Menschen ein ungeheures Potenzial verschaffen, um letzten Endes in alle verfügbaren Lebensräume der Erde zu expandieren, d.h. alle natürliche Ressourcen seinen Interessen zu unterwerfen. Eben hierdurch ist der Mensch zur offenbar erfolgreichsten Spezies des Planeten geworden – und zugleich auch zu einer Bedrohung für ihn.*16*
Was die Vorhersage bzw. das Management der Entwicklung von Ökosystemen noch zusätzlich erschwert, das sind die unterschiedlichen Zeitskalen, auf denen sich die ökosystemischen Prozesse abspielen (mit der Folge, dass z.B. die effektive Regeneration von Waldbeständen oder Tierpopulationen unterschiedlich viel Zeit benötigt); ebenso kumulative Prozesse (die besonders bei Kontaminationen auftreten können und oft nur schwer zu bremsen sind); schließlich auch periodische Schwankungen (etwa in den Größen einer Räuber- und einer Beutepopulation) oder klimatische Rhythmen (z.B. beim El Nino-Phänomen). Denn auch diese lassen sich, trotz ihrer Regelmäßigkeit, nur in Grenzen hinsichtlich ihrer Wirkungskraft prognostizieren und modellieren. Aber immerhin liefern sie einen Rahmen, innerhalb dessen die „Ordnung der Natur“ grundsätzlich verstanden werden kann.*17* Allein die Kenntnis der universellen Naturgesetze reicht jedoch nicht aus, um die spezifischen Verhaltensmuster von komplexen Ökosystemen zu verstehen: Die eigentümlichen „Spielregeln“, von denen der Aufbau und die Funktionsweise der verschiedenen Ökosysteme bestimmt werden, überschreiten zwar nirgendwo die naturgesetzlichen Rahmenbedingungen, aber direkt auf Physik und Chemie reduzieren lassen sie sich nicht. Und dies ist vielleicht die wichtigste Lehre, die sich aus der Analyse von Ökosystemen ziehen lässt.
*12*Lange Zeit hatte man geglaubt, dass die Gene alles bestimmen, was in einem Organismus geschehen kann. Inzwischen aber weiß man, dass auch andere Zellprozesse die Wirkungsweise der Gene erheblich beeinflussen (etwa über die Faltung der DNA), sodass es zu Rückkopplungen zwischen verschiedenen Regulationsebenen kommen kann. Darüber hinaus hat man auch so genannte „epigenetische“ Mechanismen entdeckt, die vor allem in Stresssituationen die DNA auf eine bestimmte Weise markieren (methylisieren), sodass die Expression bestimmter Gene verstärkt oder abgeschwächt wird. Diese epigenetische Modifikation der Genexpression kann sogar über mehrere Generationen hinweg vererbt werden, bevor sie wieder verschwindet.
*13*Dass z.B. organismische Systeme dazu in der Lage sind, unerwartet neue Eigenschaften anzunehmen, dies zeigt sich etwa bei Tieren, die mit einem Gehirn ausgestattet sind: hier treten mit einem Male mentale Eigenschaften wie Bewusstsein, Sinnesempfindungen und Emotionen in Erscheinung, die zwar einer materiellen Grundlage bedürfen (eben eines zentralen Nervensystem als Subsystem des Organismus), die sich aber den neuronalen Prozessen von außen nicht ansehen lassen, da sie sich ausschließlich in der inneren subjektiven Erfahrung einer Psyche offenbaren. Niemand vermag bisher zu sagen, wie das Gehirn zu seinen psychischen Funktionen und Erlebnissen kommt, doch ist dieses Rätsel (das so genannte „Leib-Seele-Problem“) noch kein Grund dafür, die Existenz einer eigenständigen, d.h. vom Gehirn unabhängigen Psyche anzunehmen, wie dies von den Religionen in der Regel postuliert wird. Immerhin zeigt das Beispiel der Emergenz von mentalen Eigenschaften im Bereich der höheren Lebewesen, dass man bei komplexen Systemen immer mit Überraschungen rechnen muss. Schon die Frage, ob auch „Leben“ ein emergentes Phänomen darstellt, hat bis heute niemand überzeugend beantworten können. Denn das, was wir empirisch vorfinden, wenn wir als Beobachter von außen an die Natur herangehen, das sind immer nur materielle oder energetische Erscheinungen, also physikalische oder chemische Entitäten und Vorgänge. Verfügen Lebewesen als solche (also bereits auf der prämentalen Stufe) über spezifische Eigenschaften, die sich nicht von ihrer Biochemie her verstehen lassen? Eigenschaften wie z.B. Eigenaktivität oder Zielstrebigkeit oder sogar „Selbstinteresse“? Verhalten sich Lebewesen nur so, als ob sie „Zwecke“ verfolgen würde, oder sind in ihnen tatsächlich „teleologische Mechanismen“ wirksam? Dies alles sind noch offene Fragen: Wie es innerhalb von bestimmten Organismen zu Vitalität und Subjektivität kommen kann, dies entzieht sich (vielleicht sogar prinzipiell) jedem rein materialistischen Verständnis der Natur. Wir verstehen hier allenfalls die Korrelationen und konditionalen Abhängigkeiten (etwa zwischen neuronalen Schaltkreisen und bestimmten Bewusstseinserlebnissen), nicht aber die Kausalität, die das objektive Geschehen mit den subjektiven Empfindungen verbindet.
*14* Was alles an Möglichkeiten, vor allem an Lernkapazitäten, in intelligenteren Tieren verborgen sein kann, dies zeigen die erstaunlichen Anpassungsstrategien etwa von Vögeln, die sich an das Leben in der Stadt gewöhnt haben, indem sie sich dort neue Nahrungsquellen erschließen (z.B. Mülltonnen inspizieren oder die Aluminiumverschlüsse von Milchflaschen aufpicken oder Nüsse von vorbeifahrenden Autos aufknacken lassen). Hierdurch sind unsere Siedlungen nicht nur für uns Menschen, sondern auch für nicht-humane „Opportunisten“ zu neuen Ökosystemen geworden.
*15*Im Bereich der humanen Sozialsysteme ist dies sogar nicht selten der Fall. Wenn z.B. ein Unternehmen in eine wirtschaftliche Schieflage gerät, sodass sein Verbleiben am Markt fraglich wird, dann kommt es mitunter zu einer Lockerung der bislang festgefügten (formellen) Managementstrukturen, indem die kreative Phantasie der Mitarbeiter auch auf den unteren Hierarchieebenen des Unternehmens plötzlich eine höhere Bedeutung erhält: nunmehr zählen die „informellen Beziehungen“ zwischen den Betriebsangehörigen in einem verstärkten Maße und die normalerweise geringen Rückkopplungen „von unten nach oben“ werden zahlreicher und bedeutsamer, wodurch das Unternehmenssystem insgesamt „informationell transparenter“ und der Prozess der Entscheidungsfindung offener wird. Hinzu kommt allerdings oft auch ein Mehr an „Fremdorganisation“, indem die Geschäftsleitung eine externe Beratungsfirma hinzuzieht, die das Unternehmen nach internen Restrukturierungsmöglichkeiten (z.B. Einsparungen und Umverteilungen) explorieren soll.
*16*Was als „evolutionärer Erfolg“ gewertet werden darf, dies ist allerdings nicht leicht zu bestimmen: Sind nicht z.B. auch die Bodenbakterien oder zahlreiche Insektenarten, die zum Teil schon seit vielen Millionen Jahren die Erde besiedeln, als mindestens so erfolgreich (wenn nicht sogar erfolgreicher) anzusehen als der Mensch, der erst seit relativ kurzer Zeit in Erscheinung getreten ist? Was wirklich „Erfolg“ ist, darüber entscheidet letzten Endes wohl erst die Dauer des Verweilens auf diesem Planeten. Auch bedeutet „komplexer strukturiert“ nicht immer auch „ökologisch fitter“: denn gerade seine enorme biologische Komplexität könnte dem Menschen schon bald zum Verhängnis werden und ihn zu einer „bedrohten Art“ werden lassen.
*17*Man sollte sich immer vor Augen halten, dass die periodischen (also regelmäßig wiederkehrenden) Abläufe in Ökosystemen als Eigenschaften von evolutionären, störungsanfälligen und flexiblen Systemen zu betrachten sind, die variabler geartet sind als die periodischen Prozesse in „konservativen Systemen“: wie etwa im Falle des Sonnensystems, wo die Planeten und Monde extrem genau ihren Bahnen folgen, sodass z.B. Sonnen- und Mondfinsternisse sehr exakt vorausgesagt werden können.
6.1.3. Verschiedene Ansätze zur Modellierung sozial-ökologischer Systeme
Das Verhältnis von Mensch und Natur in einem einzigen „sozial-ökologischen System“ zu modellieren, kommt in gewisser Weise der Realität viel näher als eine systemtheoretische Modellierung, welche die humanen Sozialsysteme den ökologischen Systemen gegenüberstellt. Denn eine solche Kontrastierung, die der traditionellen Opposition „Kultur vs. Natur“ entspricht, stellt – streng genommen – nur eine künstliche Differenzierung dar: zwar ist es richtig, dass sich (wie etwa Niklas Luhmann gesagt hat) die kommunikativen Prozesse einer Gesellschaft als ein operational geschlossenes System beschreiben lassen, relativ zu dem die Natur als ökologisches Gesamtsystem („Gaia“) nur die Umwelt der Gesellschaft bildet; aber zum einen dreht sich die innergesellschaftliche Kommunikation nicht wenig um die Austauschbeziehungen mit der Natur und zum andern sind die Menschen, die sozialen Akteure, nicht nur Bürger sozial-kultureller Gemeinwesen, sondern immer auch Naturwesen. So gesehen, nämlich aus anthropologischer Sicht, ist die Natur uns nicht nur als Umwelt, sondern zugleich auch als „Inwelt“ präsent; was schon dadurch sichtbar wird, dass wir alle einen Körper haben, d.h. biologische Organismen sind und daher ernährt, geschützt und gepflegt werden müssen, um überhaupt existieren zu können.*18* Biologisch betrachtet sind wir nur „höhere Tiere“ mit besonderen geistigen und sprachlichen Fähigkeiten, aber gleichzeitig auch mit „natürlichen Bedürfnissen“ ausgestattet, die wir nur materiell befriedigen können. Die Art und Weise, wie wir mit unserem eigenen Körper oder mit den Körpern anderer Menschen umgehen, mag ja kulturell geprägt oder „überformt“ sein, aber unsere Körper bleiben dennoch durch und durch organische Körper, also „Naturdinge“, die wir bei der körperlichen Arbeit einsetzen (trotz aller Unterstützung durch allerlei Technik) oder mit denen bzw. an denen wir Gewalt ausüben (im Krieg, bei körperlichen Züchtigungen oder beim Begehen von Gewaltverbrechen). Nicht zuletzt auch benötigen wir für unser leibliches Fortbestehen und Wohlergehen Lebensmittel, Kleidung und Behausungen; sowie auch die Leistungen der Medizin, wenn wir krank werden, oder der physischen Hygiene und gesundheitlichen Prävention, um gar nicht erst zu erkranken. Im Grunde ist es sogar so, dass unser Körper, unsere Naturhaftigkeit, geradezu im Mittelpunkt des gesellschaftlichen Lebens steht – und dies gilt auch für den Vollzug unserer Kommunikationen, die selbst im Falle einer Verwendung von Kommunikationstechnologien letztlich leibgebunden bleiben.*19* Unsere biologische Natur macht sich überall geltend: in der Arbeit und Sexualität, bei Sport, Spiel und Tanz, bei Zeugung und Mutterschaft.
Mit anderen Worten: Die kulturellen Humansysteme sind immer schon mit den ökologischen Natursystemen auf das Innigste verschränkt, weil wir selbst ökologisch eingebundene Naturwesen „verkörpern“. Daher ist es richtig, weil der Sache angemessen, dass die Theorie der „sozial-ökologischen Systeme“ die menschlichen Kulturaktivitäten von vornherein als integriert in das umfassendere ökologische System der Erde betrachtet (auch wenn sie aus methodischen oder pragmatischen Gründen oft nur lokale oder regionale Ausschnitte aus diesem globalen Ökosystem ins Auge fasst). Das globale Ökosystem mag zwar in human-kulturelle Systembildungen einerseits und „rein natürliche“ Ökosysteme andererseits substrukturierbar (also subsystemisch differenzierbar) sein, die sodann miteinander wechselwirken, aber eigentlich gibt es nur ein einziges „universales“ sozial-ökologisches System: den Planeten Erde als ganzen. Und was ist mit dessen Umwelt? Nun, das ist alles das, was bereits ein bekanntes Kinderlied benennt: „Sonne, Mond und Sterne“. Allerdings ist für das Ökosystem Erde nicht alles gleich relevant, was den „Weltraum“ ausmacht: am Wichtigsten ist hier wohl die Sonne, die der Erde Licht spendet; sodann wäre der Mond zu nennen, der z.B. an der Regulierung der Gezeiten beteiligt ist; schließlich auch die kosmische Strahlung aus elektrisch geladenen Teilchen, die zum Glück größtenteils vom Erdmagnetfeld reflektiert oder zu den Polen hin abgelenkt wird, wo es dann oft zu den faszinierenden Polarlichtern kommt.*20*
Hier zeigt sich auch, dass nahezu alle Systeme (insbesondere jene im Naturbereich) letztlich theoretische Konstruktionen sind: Was wir in der Natur tatsächlich wahrnehmen, dies sind immer nur auffällige Wechselwirkungen, Abhängigkeiten, Korrelationen, Kausalbeziehungen usw., aber um in diesem Wirrwarr auch Systeme „sehen“ zu können, hierzu müssen wir Systemmodelle konstruieren, deren Grenzen zu ihrer Umwelt hin oft verschwimmen oder fließend sind: Im Falle einer isolierten Wüstenoase ist es noch relativ leicht, diese als ein zur Wüste hin abgegrenztes System aufzufassen; doch schon beim Wattenmeer oder einem Atoll gelingt eine solche Abgrenzung zum offenen Meer nicht so leicht; und erst recht nicht beim tropischen Regenwald, der an seiner Rändern überall ausfranst, sodass man nicht genau sagen kann, wo er eigentlich beginnt und wo er aufhört.*21* Und ab wie vielen Bäumen und mit welchem Baumabstand entsteht eigentlich das Ökosystem eines Waldes? Natürlich erfolgt die wissenschaftliche Abgrenzung eines Ökosystems gegenüber seiner Umwelt nicht beliebig oder willkürlich, sondern stets auf der Basis bestimmter Kriterien (also gemäß bestimmter empirischer Indikatoren, allgemeiner Definitionen und pragmatischer Gesichtspunkte), aber letztlich müssen wir irgendwo eine mehr oder minder klare Grenzlinie ziehen, um überhaupt zu einem „System“ zu gelangen, dessen Verhalten wir sodann analysieren können. Ob wir unsere Systemabgrenzung richtig vorgenommen haben (oder ob sie zu weit bzw. zu eng ausgefallen ist), dies zeigt sich im Grunde erst in der Praxis, d.h. am Erfolg unserer modellgestützten Voraussagen über seine Entwicklung oder auch am Erfolg unserer Eingriffe in das System, wenn sich alles genauso entwickelt, wie wir es intendiert hatten. Und bei der Angemessenheit einer bestimmten Systemmodellierung geht es ja nicht nur um die richtige räumliche Abgrenzung des Systems, sondern auch darum, alle relevanten Faktoren (alle Parameter und Variablen) erfasst zu haben, sodass wir zu einem vollständigen Bild des vermuteten Systemzusammenhangs gelangen.*22* Wie in der (Natur-) Wissenschaft allgemein üblich, ist an die Stelle des Wahrheitskriteriums das Erfolgskriterium getreten: Wie die Natur an sich beschaffen ist, dies vermag niemand zu sagen, sodass wir uns auf die Plausibilität unserer theoretischen Prämissen sowie auf den Erfolg unserer experimentellen Erwartungen und computergestützten Modellbildungen verlassen;*23* wofür etwa die Klimamodelle des IPCC (des „International Panel of Climate Change“) ein gutes Beispiel liefern. Dies galt aber schon für die frühen Zukunftsszenarien in den Berichten des „Club of Rome“.
Denkt man also die Theorie sozial-ökologischer Systeme zu Ende, dann verwandelt sich das ursprüngliche System-Umwelt-Verhältnis in ein umfassendes Weltverhältnis, in dem der Mensch sich als kulturell handelndes Subjekt und zugleich als „Objekt“ (genauer: als Bestandteil) der Natur betrachten kann bzw. sollte: er ist eher ein Mitspieler innerhalb der Natur als deren Beherrscher und Umformer (obwohl er natürlich schon die Natur nach seinen Interessen umzuwandeln und auszunutzen versucht). Jedenfalls sollte er kein Gegenspieler der Natur sein, da er letztlich (wie alles andere auch) deren Gesetzen unterworfen ist. Und dies gilt auch für sein geistiges und moralisches Werden, das sich letzten Endes immer auch an den empirischen Gegebenheiten orientieren und bewähren muss: so kann z.B. für sinnliche Wesen, wie wir es sind, auch die Ethik nicht umhin, unsere körperliche Bedürftigkeit, unsere Verletzlichkeit und Sterblichkeit zu einem wesentlichen Ausgangspunkt für alle moralischen Erwägungen zu machen. Und dies schließt auch unser moralisches Verhältnis zu den nicht-humanen „Mitgeschöpfen“, den Tieren und vielleicht sogar den Pflanzen, mit ein, insofern auch diese aufgrund ihrer physischen Schmerzempfindlichkeit einen Anspruch auf unseren Respekt haben. Somit wird eine sozial-ökologische Betrachtung der Gesamtwirklichkeit auch die tier- und naturethische Dimension berücksichtigen müssen, womit dann auch die Philosophie mit in das „interdisziplinäre Setting“ gehört. Wie denn überhaupt die Achtsamkeit im Umgang mit der Natur stets auch eine ethische Komponente enthält – sogar dann, wenn es nur um die Schonung von Bodenschätzen geht. Im Kontext einer Welt ist grundsätzlich alles gleich wichtig und gleichwertig – aber nichts gleichgültig oder überflüssig.*24*
Anders formuliert: der Mensch stellt nur ein einzelnes Glied innerhalb der extrem verzweigten „chain of beings“ dar – und kann sich weder daraus lösen noch gar darüber erheben (auch wenn manche Religionen und Ideologien uns dies gern einreden möchten). Die Geschichte der Menschheit bildet daher auch nur ein einzelnes Moment innerhalb der planetaren „big history“, die etwa auch die geologischen Aspekte (z.B. die Plattentektonik und Gesteinsbildung) und die Entwicklung des Klimas mit berücksichtigt, um auf diese Weise das allmähliche Gewordensein des Menschen aus einer „globalen Perspektive“ heraus zu rekonstruieren. Wenn also auch die Vertreter der sozial-ökologischen Systemtheorie bei ihren Modellierungen gelegentlich die menschliche Kultursphäre der Natursphäre gegenüberstellen, da sich der Mensch mit seinen besonderen Bedürfnissen nun einmal gern der Natur gegenüber sieht, dann ändert dies nichts daran, dass der sozial-ökologische Ansatz ein fundamental globalsystemischer Ansatz ist (trotz aller lokalen oder regionalen Differenzierungen bei bestimmten praktischen Fragestellungen).
Wie nicht anders zu erwarten, so gibt es zahlreiche Definitionen von sozial-ökologischen Systemen (SES), von denen hier nur die vielleicht komplexeste angeführt sei, zumal in ihr viele der oben diskutierten Aspekte solcher Systeme einbezogen werden: Nach dieser Definition verkörpern SES „complex adaptive systems with key characteristics such as: (1) integrated biogeophysical and socio-cultural processes, (2) self-organization, (3) nonlinear and unpredictable dynamics, (4) feedback between social and ecological processes, (5) changing behavior in space (spatial thresholds) and time (time thresholds), (6) legacy behavioral effects with outcomes at very different time scales, (7) emergent properties, and (8) the impossibility to etrapolate the information from one SES to another” (Delgado-Serrano et al. 2015). *25*
Seit den 1990er Jahren sind zahlreiche SES-Ansätze entwickelt worden, die hier nicht im Einzelnen dargestellt werden sollen, obwohl von ihnen zum Teil sehr unterschiedliche Aspekte von SES hervorgehoben und analysiert werden. G. S. Cumming (2014), der selbst einer der frühestens und wichtigsten Vertreter des SES-Ansatzes ist, hat eine Einteilung der unterschiedlichen SES-Rahmentheorien („frameworks“) in fünf Kategorien vorgeschlagen, die hilfreich sein kann, um einen gewissen Überblick zu bekommen. Er unterscheidet „(1) hypothesis-oriented frameworks; (2) assessment-oriented frameworks, (3) action-oriented frameworks, (4) problem-oriented frameworks; and (5) theory-oriented frameworks”.
Zusammen mit Cumming sollen uns insbesondere die “theory-oriented frameworks” interessieren, die nach Cumming sieben „assessment criteria“ genügen sollten. Aufgrund ihrer Bedeutung sollen diese Kriterien hier vollständig zitiert werden (Cumming 2014):
- 1. Sozial-ökologischer Kern: Ein Rahmenwerk kann seinen Ursprung entweder in den Sozial- oder in den Ökowissenschaften haben, aber es muss eine klare Möglichkeit bieten, soziale und ökologische Systeme miteinander zu verbinden und in beiden Disziplinen stark zu sein. Rahmenwerke, die sich in erster Linie mit Ökonomien befassen und den Anspruch erheben, interdisziplinär zu sein, weil sie Ökosystemgüter und -dienstleistungen erwähnen, oder für Ökosysteme geschaffene Rahmenwerke, die indirekt anthropogene Triebkräfte der Habitatveränderung einbeziehen, erfüllen dieses Kriterium nicht. Ausgeschlossen sind auch konzeptionelle Rahmenwerke, die allgemeine Denkweisen über die Welt anbieten, wie die integrale Theorie, aber keine spezifischen Aussagen über sozial-ökologische Beziehungen machen.
- 2. Empirische Unterstützungs- und Übersetzungsmodi: Rahmenwerke, die den Anspruch erheben, wissenschaftlich zu sein, wie elegant sie auch sein mögen, sollten durch rigorose empirische Studien gestützt werden. Analysen, Ergebnisse und Schlussfolgerungen sollten zumindest prinzipiell wiederholbar sein, und verschiedene Wissenschaftler sollten idealerweise unabhängig voneinander zu den gleichen Schlussfolgerungen gelangen. Zum Kriterium der empirischen Untermauerung gehört auch das Falsifikationskriterium nach Popper; es sollte prinzipiell möglich sein, Gegenbeispiele zu finden oder empirische Behauptungen zu widerlegen. Ebenso sollten Rahmenwerke Übersetzungsmodi enthalten, die es erlauben, Theorie mit empirischen Beobachtungen zu verbinden und umgekehrt. Die Theorie sollte eine Möglichkeit zur Unterscheidung zwischen signifikanten und irrelevanten Beobachtungen bieten; und umgekehrt sollte die Beobachtung eine Möglichkeit zur Unterscheidung zwischen signifikanten und irrelevanten Theorien bieten. Dies ist nicht möglich, wenn die Vorhersagen einer Theorie nicht in Form von überprüfbaren Hypothesen formuliert werden können.
- 3. Mechanismen: Rahmenwerke sollten Einblicke in die Kausalität bieten. Sie sollten idealerweise auf ersten Prinzipien oder zumindest auf akzeptierten Beobachtungen beruhen und klare Aussagen über Ursache und Wirkung bieten. Rahmenwerke für SES sollten auch Erklärungen für die komplexen Verhaltensweisen bieten, die bei SES in der realen Welt beobachtet werden. Systembeschreibungen allein, ob von Systemelementen oder Systemverhalten, bieten keinen vollständigen Rahmen.
- 4. Räumlich-zeitliche Dynamik: Rahmenwerke sollten sich mit den dynamischen Aspekten des SES und der Art der Veränderung im Laufe der Zeit sowie mit der räumlichen Natur des SES und der räumlichen Variation befassen.
- 5. Disziplinärer Kontext: Frameworks sollten sich auf frühere Frameworks beziehen und idealerweise in der Lage sein, ihre Schwächen zu erklären und/oder ihre Stärken einzubeziehen. In einer Disziplin wie der Physik zum Beispiel baut die Relativitätstheorie auf der Newtonschen Physik auf und erweitert sie, anstatt sie zu verwerfen oder zu ignorieren. Meiner subjektiven Ansicht nach hat das Studium der SES unter einem Übermaß an isolierter Entwicklung von Rahmenwerken mit zu wenig Synthese zwischen den Rahmenwerken und zu viel Ignoranz gegenüber vorhergehenden Ideen gelitten.
- 6. Interdisziplinarität und Transdisziplinarität: Dies baut auf dem vorhergehenden Kriterium des disziplinären Kontextes auf, aber im weiteren Sinne. Rahmenwerke für SES sollten in der Lage sein, mit komplementären Perspektiven und verschiedenen Epistemologien umzugehen und Verbindungen zwischen ihnen herzustellen.
- 7. Richtung: Rahmenwerke sollten der Untersuchung von SES eine Richtung geben, indem sie neue empirische Studien vorschlagen oder anleiten, die unser theoretisches Verständnis von SES voranbringen.
Allgemein kann unter einem „framework“ eine „family of models” verstanden werden, die „not necessarily depend on deductive logic to connect different ideas (i.e., it does not have to present a single argument in which the conclusions follow from the premises)”. Zum Beispiel kann ein solches „framework” die SES als interaktionelle Systeme von Menschen und Natur betrachten und dabei verschiedene Sub-Module aufweisen, die primär auf die sozialen Aspekte des SES fokussieren, wie etwa die Entscheidungsfindung innerhalb von sozialen Netzwerken. Streng genommen, sind „frameworks“ immer „metatheoretical schema facilitating the organization of diagnosis, analysis, and prescription“. Solche Rahmenwerke beziehen sich auf unterschiedliche Zielsetzungen und sind niemals „richtig” oder „falsch”. Hierin gleichen sie Weltbildern, die auch nicht „wahr“ oder „unwahr“ sein können, da durch sie erst die Kriterien für die Beurteilung von Aussagen gesetzt werden. Dies bedeutet, dass „frameworks“ immer auch die epistemologischen Bedingungen festlegen, unter denen SES grundsätzlich beobachtet und analysiert werden können.
Keine der existierenden SES-Theorien erfüllt bereits alle sieben Kriterien, sodass Cumming feststellt: „The development of a stronger theoretical framework remains an important goal for SES theory“ bzw. „we still lack a cohesive body of SES theory“. Vor allem hinsichtlich ihrer Epistemologie unterscheiden sich die zentralen SES-Theorien oft wesentlich, da sie auf unterschiedliche Weise ihre eigenen epistemischen Vorausssetzungen mitreflektieren, sich also in unterschiedlichem Maße ihrer eigenen Bedingtheit bewusst sind. Hier zeigt sich oft eine gewisse Naivität im Verfolgen des gewählten Ansatzes, d.h. ein Mangel an Selbstreflexion. Zu wenig würde von ihnen berücksichtigt, „that the processes by which decisions are made directly influence their outcomes“. Die Entwicklung einer kohärenteren Theorie hängt nach Cumming insbesondere davon ab, dass in folgenden drei Hinsichten weitere Fortschritte erzielt werden: „(1) the development of better standards and more effective ways of assessing the quality of SES research, increasing rigor in analyses of SESs; (2) the creation of clearer linkages from the specific to the general, with case studies contributing more obviously to theoretical advancement; and (3) the development of better translation modes using theoretical constructs to generate evidence-based recommendations for social-ecological interventions which would enhance desirable aspects of social-ecological resilience“. Zu den Eigentümlichkeiten insbesondere sozialer Systeme als Bestandteile von SES gehört es, dass nicht nur die Vorannahmen über die Beschaffenheit und Abgrenzbarkeit eines SES eine Rolle bei dessen Analyse spielen, sondern auch die Ergebnisse jeder SES-Analyse auf die Betrachtungsweise des SES-Analytikers zurückwirken, sodass jede angemessene SES-Analyse immer auch eine Analyse der supponierten Voraussetzungen implizieren muss (sozusagen eine „Selbstanalyse“). Es geht hier folglich nicht nur um die Entwicklung und Anwendung von mathematischen Formeln zur Beschreibung von natürlichen SES-Phänomenen, sondern auch um das methodische und von bestimmten Interessen gesteuerte Selbstbild des SES-Wissenschaftlers. Zu Recht sagt Cumming daher: „Rather, because of the ‚Social‘ in SES, they will need to take into account the unique properties of social systems and the unavoidable subjectivity involved in analyzing ourselves”. Hier zeigt sich auch das, was wir oben unter dem Begriff des „Konstruktivismus” hinsichtlich der Konstruktion „sozial-ökologischer Systeme“ behandelt haben: Die empirische Erhebung objektiver Daten und deren Einspeisung in bestimmte epistemische und pragmatische Modelle verknüpft immer Objektivität mit Subjektivität, insofern es keine „interessenlose“ Beschreibung und Erklärung des Verhältnisses von sozialen und ökologischen Systemen geben kann. Unsere praktischen Interessen gegenüber der Natur beeinflussen stets unseren theoretischen Blick auf sie.
Doch welchen Ansatz man auch bevorzugen mag, immer ist zu beachten, dass das „ecological knowledge and understanding“ eine kritische Verbindung zwischen komplexen und dynamischen Ökosystemen einerseits und adaptiven Managementpraktiken sowie öffentlichen Institutionen und sozialen Netzwerken andererseits darstellt; etwa so, wie dies Colding und Barthel (2019) vorgeschlagen haben:
Fig. 1: Dieses Schema ist die Modifikation eines Schemas von Folke und Berkes (1998)
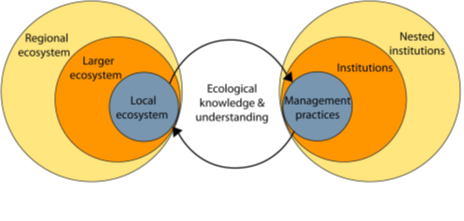
SES-Rahmenwerke können sehr komplex strukturiert sein und in ihrer praktischen Umsetzung zahlreiche Arbeitsphasen aufweisen. Dies sei an dem Beispiel eines problem-orientierten SES-Ansatzes demonstriert:
Fig. 2: An example of a problem-oriented framework: the resilience analysis framework of Walker et al. (2002).

Und dies ist noch ein relativ einfaches Beispiel, insofern hier nur die wichtigsten Faktoren und Prozessschritte im Hinblick auf den speziellen Aspekt der Resilienz schematisch dargestellt werden. Jede profunde SES-Theorie, die alle relevanten Faktoren einzubeziehen bestrebt ist, wird zahlreiche Variablen berücksichtigen müssen, deren Bewertung und Verknüpfung alles andere als einfach ist – besonders dann, wenn es um die Durchführung von empirischen Studien und die Formulierung sowie Umsetzung von managerialen Entscheidungen (Maßnahmen) geht. Im Folgenden seien zumindest die wichtigsten dieser Variablen (oder Faktoren) aufgelistet (nach Partelow 2018: 36):
- Operative Auswahlregeln
- Systeme der Eigentumsrechte
- Normen, Vertrauen, Soziales Kapital
- Geschichte oder
- frühere Erfahrungen Regierungsorganisationen
- Wirtschaftlicher Wert
- Räumliche und zeitliche Verteilung
- Vorhersagbarkeit der Systemdynamik
- NGOs
- Verfügbare Technologien
- Investitionstätigkeiten
- Demographische Entwicklungen
- Klima-Muster
- Muster der Umweltverschmutzung
- Selbstorganisierende Aktivitäten
- Lobbying-Aktivitäten
Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)Diese Liste bietet zwar nur eine Auswahl, soll aber ein Gefühl für die Vielzahl der zu berücksichtigenden Variablen vermitteln; wozu dann die Komplexität der Vernetzung und der wechselseitigen Abhängigkeiten aller dieses SES-Variablen noch hinzukommt. Hierbei wird man gewisse modellhafte Verinfachungen im Sinne einer „Reduktion von realer Komplexität“ kaum vermeiden können; ganz so, wie sie auch mit der Durchführung konkreter Maßnahmen einhergehen, durch welche das Verhältnis zwischen Mensch und Natur „geregelt“ werden soll. Die Natur verzeiht aber selten derartige Vereinfachungen, da sie immer mit allen Details zugleich vorhanden und wirksam ist. Turner et al. stellen daher zu Recht fest: In der Praxis sind „four common general elements of human interventions“ zu beachten, die zu negativen Auswirkungen führen können: nämlich „simplification, reduction in natural variability, fragmentation and loss of contigious processes, and the introduction of hard boundaries” (Turner et al. 2001).
Dies gilt insbesondere auch, wenn bestimmte „protected areas“ innerhalb der Ökosphäre eingerichtet werden sollen: „For example, in the context of protected areas, people may reduce hibitat diversity, harvest animals or plants […] or construct fences that limit movement and population expansion“. Dies kann sehr einschneidende Konsequenzen nach sich ziehen: „As ecosystems respond to intervention and use by people, they often do unexpected things; for example, pest outbreaks and unusually large fires occur, forests are lost, or shollow lakes become dominated by toxic algae.” (Cumming/Allen 2017: 1710) Alle diese Gefahren stellen die SES-Theorien vor große Herausforderungen, wobei insbesondere drei Themen herausragen, die von den SES-Theorien bewältigt werden müssen: „They [have to] include (1) increasing attention to the resilience and sustainability of protected areas and the landscapes in which they occur; (2) increasing consideration of the relevance of spatial context and scale for protected areas and the ecosystems services they provide; and (3) efforts to reframe what protected areas are und how they both define and are defined by the relationships of people and nature.“ (Cumming/Allen 2017: 1710). Die zitierten Autoren legen hierfür ein Schema vor, in dem die „socio-ecological feedbacks” zwischen den Interventionen des Menschen und den Reaktionen eines Schutzgebietes dargestellt werden:
Fig 3: A systems perspective on social-ecological feedbacks in protected area management. In addition to interactions and feedbacks that occur within protected areas, their direct outputs have add-on effects that subsequently influence both their internal dynamics and their future outputs (Cumming/Allen 2017: 1711).
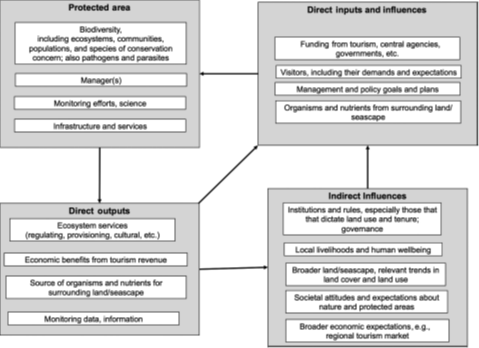
Es war vor allem das wachsende Bewusstsein von der Komplexität möglicher ökosystemischer Rückwirkungen, die nur sehr bedingt vorhersagbar sind, das die SES-Theorie auf den Plan gerufen hat. Der SES-Ansatz hat zu einem regelrechten Perspektiven- oder Paradigmenwechsel im ökologischen Denken und insbesondere auch beim Management von „protected areas“ geführt: „The shift in thinking entailed by SES approaches is to move away from efforts to optimize production, and toward less ‚efficient‘ but ultimately more resilient and more sustainable ways of achiving conservation and socioeconomic goals“. (Cumming/Allen 2017: 1711)
Versucht man nun, die zentralen Komponenten von SES zu bestimmen, dann gelangt man z.B. zu dem folgenden Schema, das zeigt, wie eng und zugleich komplex die „soziale Dimension“ mit der „ökologischen Dimension“ verknüpft ist (auch wenn diese Darstellung vor allem für das „ecological assessment“ von Landnutzungen in den Tropengebieten Amazoniens entwickelt wurde):
Fig. 4: Zitiert aus Gardner et al. 2013
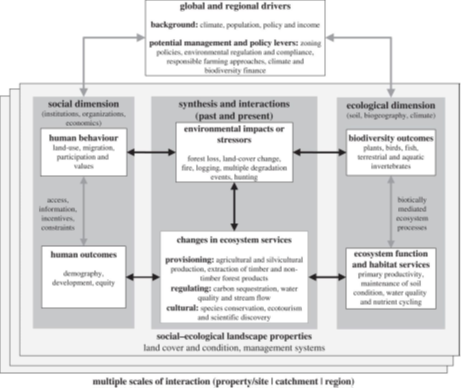
Abschließend sollen die wichtigsten Herausforderungen zusammengefasst werden, denen sich jede SES-Theorie stellen muss und die im Erfolgsfalle zugleich jene Lernerfolge markieren, die in theoretischer und praktischer Hinsicht unerlässlich sind, um sozial-ökologische Systeme angemessen managen zu können:
„Some of these that seem to us to be of highest priority include (1) developing and working with spatial data sets, such as atlases and remote sensing data, to better understand spatial dynamics and the role of heterogeneity within protected areas; (2) developing a better general framework to facilitate or direct the interactions of protected areas with their surrounding landscapes, including both ecological and socioeconomic spillover effects; (3) learning to align ecological, social, and economic processes and their interactions, particularly where spatial, temporal, or functional mismatches between scales (…) are possible; and (4) developing a better understanding of when feedbacks between social and ecological system elements are important and when they can largely be disregarded.” (Cumming/Allen 2017: 1713)
In der Absicht dieses Kapitels lag es, genau diese Erfordernisse dem (nicht nur jungen) Leser aufzuzeigen und nahezubringen: Geht es doch darum, dem heutigen Menschen ein „systemisches Denken“ zu vermitteln, das zwar nahezu überall, besonders jedoch in sozial-ökologischen Zusammenhängen von überragender Bedeutung ist. Vor allem der Umgang mit Komplexität und das Verständnis von nichtlinearen Prozessen sind unerlässlich, wenn ein „neuer Vertrag“ mit der Natur geschlossen und eine lebenswerte Zukunft für alle Lebewesen auf diesem Planeten ermöglicht werden sollen.
*18*Wie vieldeutig und vage die System-Umwelt-Beziehung ist, wird uns bewusst, wenn etwa jemand von „seiner“ Lebensumwelt spricht, wobei er zumeist sein Wohnumfeld oder sein soziales Milieu meint. Hierbei fungiert der Sprecher gewissermaßen als das „Referenzsystem“, auf das hin er alles andere um ihn herum bezieht. Und in der Tat bildet ja auch jedes einzelne Lebewesen bereits ein komplexes organismisches System, für das alles andere zu seiner Umwelt gehört. Somit gibt es – streng genommen – so viele Umwelten wie es Bezugssysteme gibt, also unzählig viele.
*19*Dass nahezu alles in der Gesellschaft vom Körperlichen durchdrungen ist, ja von ihm getragen wird, dies wird uns gerade in „Corona-Zeiten“ besonders schmerzlich bewusst, da wir untereinander „physical distance“ üben müssen und uns die körperliche Nähe unserer Mitmenschen zunehmend zu fehlen beginnt; umgekehrt kann der möglicherweise infizierte Körper des anderen Menschen aber auch zu einer Bedrohung werden.
*20*Was den Rest des Sonnensystems sowie den Raum der Fixsterne anbetrifft: deren Existenz macht sich auf die ökologische Erdentwicklung vorwiegend in historischer Perspektive geltend – etwa dann, wenn ein größerer Meteor auf der Erde aufschlägt (was in der Vergangenheit der Erde schon zu einigen „great extinctions“ geführt hat: wie etwa zum Aussterben der Dinosaurier am Ende der Kreidezeit vor ca. 65 Millionen Jahren). Doch verglichen mit dem erheblichen Einfluss etwa des erdeigenen Vulkanismus und der zum Teil erdbahnbedingten Eiszeiten sind die sonstigen Einwirkungen des ferneren Weltalls auf die Erdgeschichte eher als marginal oder subtil zu bezeichnen. Insgesamt kann man schon sagen, dass das „Raumschiff Erde“ ein weitgehend geschlossenes System bildet, das von dem extrasolaren Rest des Universums kaum bzw. nur selten tangiert wird.
*21*Am eindeutigsten gelingt eine System-Umwelt-Abgrenzung noch dort, wo wir es mit Gebilden zu tun haben, die wir auch als Realitäten „bottom up“ selbst konstruiert haben: z.B. bei Unternehmen, sozialen Gruppen oder politischen Institutionen, die schon von ihrer Funktionsweise her auf einer klaren und arbiträren Grenzziehung zwischen interner Organisation („innerem Milieu“) und externer Umwelt („äußerem Milieu“) beruhen. Solche funktional eindeutigen Grenzziehungen finden wir in der Natur eigentlich nur dort, wo sich ein Lebewesen eine Zellmembran (wie im Falle eines Einzellers) oder eine Außenhaut (wie beim Menschen) selbstorganisiert hat, sodass es sich aktiv gegenüber seiner Umwelt abgrenzt, um auf diese Weise „autonom“ (wenn auch nicht autark) zu werden. Eine solche selbstorganisierte „Membran“ finden wir aber bei Ökosystemen nicht.
*22*Dies kann u.U. recht schwierig sein, wenn man bedenkt, dass z.B. die meisten Bodenbakterien noch gar nicht bekannt sind. Auch verstehen wir noch längst nicht alle Mechanismen, die die Strömungssysteme in der Atmosphäre oder in den Weltmeeren antreiben. Und auch die terrestrischen und maritimen Nahrungsketten sind noch keineswegs vollständig erforscht.
*23*Wenn z.B. ein Laborexperiment ein gutes und die theoretischen Vorannahmen bestätigendes Ergebnis liefert, dann sagt man nicht: „It‘s true“, sondern bescheidener: „It works“.
*24*Sogar dann, wenn man einen konsequent „anthropozentrischen“ Standunkt gegenüber der Natur vertritt, also alle Naturwesen nach ihrem Wert für den Menschen beurteilt, ohne ihnen einen besonderen Eigenwert zuzubilligen, selbst dann verlangen die direkten (primären) „Pflichten gegen sich selbst“ (wie Immanuel Kant sagt) die Beachtung der indirekten (oder sekundären) „Pflichten gegen die Natur“, da die Zerstörung der Natur auch die Vernichtung des Menschen einschließt. Auch sei Grausamkeit gegenüber schmerzempfindlichen Tieren der „allgemeinen Moralität“ (Kant) abträglich.
*25*Oder aus einer etwas anderen Perspektive heraus gesagt: „Ecosystems and social systems are characterized by bottom-up and top-down controls and thresholds, multiple scales and nonlinar dynamics.“ (Cumming/Allen 2017: 1712) Man braucht also beides: den „Blick von unten“ und den „Blick von oben“, denn in komplexen Systemen spielen hierarchische und heterarchische Strukturen immer zusammen, sodass es zu einer „self-organization“ im Sinne einer Wechselwirkung „between process and structure“ kommt.
6.2. Systematische Indikatoren
6.2.1. Organisiertes Lernen durch Jugendbildung
„Lasst uns also einen Apfelbaum pflanzen. Die Zeit ist gekommen“.
Hoimar v. Dithfurth
„Die Jugendbildung ist geprägt von ihren Institutionen, von ihrer Geschichte, von jungen Menschen und vom lebenslangen Lernen. Die traditionelle Vorstellung von zwei Lebensphasen, die ausschließlich und getrennt mit dem Erwerb oder der Anwendung von Bildung zusammenfallen, wird durch die Vorstellung ersetzt, dass organisiertes Lernen nicht auf eine Bildungsphase am Anfang des Lebens beschränkt werden kann.“ (Deutscher Bildungsrat, 1973). Können Veränderungen in der natürlichen Umwelt nicht auch kontinuierliches Lernen ermöglichen? Hier ist zunächst zu unterscheiden, dass die Lebenssituation und -erfahrung im Sinne der Vermittlung ganz anders ist als bei Kindern, und dass Selbstlernen notwendig ist. Es müssen also die Voraussetzungen geprüft werden, und sie müssen sich an dem orientieren, was junge Menschen mitbringen. (Tietgens, 1979: 25) Oder wie Horst Siebert gesagt hat: „Der junge Mensch muss selbst bestimmen können, zu welchem Zweck er lernt“.
In diesem Sinne erfordert die Erziehung junger Menschen vor allem das Bewusstsein für die implizite Interpretation von Gesellschaften im Sinne einer Umweltkrise und ist eng mit der historischen Entwicklung verbunden. Die Ziele müssen als abhängig von sozialen Interessen gesehen werden, aber die sozialen Bedingungen können sich ändern. „Deshalb kann man es wagen zu sagen, dass Lern- und Leistungsbemühungen in der emanzipatorischen Struktur in jedem Lernbereich eine demokratiefördernde Funktion erfüllen können - und umgekehrt, dass die autoritäre Lern- und Leistungsstruktur in allen Bereichen des Bildungsgeschehens, insbesondere in der Jugendbildung, wieder die technokratische Tendenz unterstützen kann“. (Strzelewicz, 1979: 134 ff.) Technokratische und emanzipatorische Ansätze sind für die ökologische Bildung junger Menschen relevant. Dabei stellt sich die Frage, in welchem Verhältnis diese Ansätze zur Überwindung der ökologischen Krise stehen. (Brumlik 1983: 406) In diesem Bereich spricht man allerdings eher von Lernzielen als von Bildungszielen. „Die Jugendbildung ist also geprägt von ihren Institutionen, von ihrer Geschichte, von jungen Menschen und vom lebenslangen Lernen. Die traditionelle Vorstellung von zwei Lebensphasen, die ausschließlich und getrennt voneinander entweder mit dem Erwerb oder mit der Anwendung von Bildung zusammenfallen, wird durch die Auffassung ersetzt, dass organisiertes Lernen nicht auf eine Bildungsphase zu Beginn des Lebens beschränkt werden kann.“ (Brumlik 1983: 406 und Siebert, 1972: 76)
Siebert (1972) findet drei Formen der Rechtfertigung:
- die Ableitung aus wissenschaftlichen Disziplinen,
- die empirische Analyse der Nutzungssituationen und
- eine Bedarfsanalyse der Adressaten. (Siebert 1972: 76)
Diese Ziele können nicht wissenschaftlich definiert werden, sondern müssen in einem gesellschaftlichen Kommunikationsprozess vor dem Hintergrund der jeweiligen historischen und gesellschaftlichen Bedingungen ausgehandelt werden. Ausgehend von dieser Hintergrundanalyse ist es als Aufgabe der Wissenschaft anzusehen, sich an der Diskussion zu beteiligen. Dies bedeutet, dass sich die Ziele zwar aus der wissenschaftlichen Disziplin ableiten, aber nicht absolut gesetzt werden können. Vielmehr sind sie als ein Beitrag zu einem gesellschaftlichen Diskurs zu verstehen, in den zumindest die Lehrenden und die Akteure der Jugendbildung einbezogen werden müssen.
Drei Aspekte der Ökologie sind hier relevant:
- der wissenschaftliche, der vor allem harte Fakten, d.h. technisch-biologisches Wissen, umfasst
- der philosophische, der ästhetische und ethische Fragen behandelt, sowie
- das Politische.
Sie stellt die menschliche Gesellschaft in den Mittelpunkt der Mensch-Natur-Beziehung. „Ökologie kann definiert werden als die Wissenschaft von den Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Organismen, zwischen Organismen und den auf sie einwirkenden Umweltfaktoren sowie zwischen verschiedenen Umweltfaktoren. Organismen werden hier definiert als Mikroorganismen, Pflanzen, Tiere und Menschen.“ (Bick, 1987: 16 ff.).(Bick, 1987: 16 ff.) Die Natur wird als ein lebenserhaltendes System für den Menschen gesehen; auch der Mensch ist Teil der Natur. Die Ökologie als biologische Wissenschaft stellt die Natur systematisch dar. (Odum, 1991: 43)
Es können verschiedene Prinzipien unterschieden werden:
- Das erste ist die hierarchische Struktur, d.h. eine Abfolge von Funktionseinheiten. In der ökologischen Hierarchie lassen sich die Einheiten Organismus, Population, Biozönose, Ökosystem, Landschaft sowie Biome, biogeographische Region und Biosphäre unterscheiden.
- Das zweite Prinzip ist die funktionale Integration und bedeutet, dass jede Ebene der Hierarchie die angrenzenden Ebenen beeinflusst. (Odum, 1991: 43)
- Das dritte Prinzip ist die Homöostase. Homöostatische Mechanismen sind Ausgleich, Kräfte und Regelkreise.
Damit wollen wir als unsere Position deutlich machen, dass sich eine Diskussion über Ökologie angesichts der Umweltkrise nicht mit technologischen Entwicklungen oder Schadensbeschreibungen begnügen darf, sondern dass im Sinne einer kritischen Aufklärung eine „Grundsatzdiskussion über die Orientierungskrise des Fortschritts“ im weitesten Sinne für die Suche nach einer neuen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung notwendig ist. (Altner 1982: 16) Gemeint ist hier insbesondere die Beteiligung des Einzelnen und seine Fähigkeit dazu, aber auch die Infragestellung gesellschaftlicher Strukturen. Der Begriff der Ökologie wird hier also bestimmt durch die Beschreibung der Umwelt durch den Menschen, durch die Bewertung der Umwelt durch den Menschen und durch sein Handeln in der Umwelt.
6.2.2. Indikatoren für eine nachhaltige Entwicklung
Die Jugendbildung ist daher das erste Semester. Der zweite ist, wie man die Indikatoren für sozial-ökologische Produktionslandschaften umgehen kann. Diese müssen im Sinne eines organisierten Lernens, das sich nicht auf eine Bildungsphase am Lebensanfang beschränken kann, über die ökonomischen und ökologischen Probleme eingeführt werden.
Das Konzept der nachhaltigen Entwicklung ist die zentrale Vision für die Zukunft der Menschheit im 21. Jahrhundert. Auf der Grundlage des Brundtland-Berichts und der Rio-Konvention von 1992 (Agenda 21) hat das Konzept der nachhaltigen Entwicklung inzwischen große internationale Bedeutung erlangt. Aus Verantwortung für die sozialen und materiellen Lebensbedingungen künftiger Generationen sollen wirtschaftliche, ökologische und soziale Belange in gesellschaftlichen Entscheidungsprozessen gleichberechtigt berücksichtigt werden. Der Landwirtschaft kommt im Rahmen der globalen nachhaltigen Entwicklung eine herausragende Bedeutung zu, denn die Sicherung der Nahrungsmittelversorgung, die Erhaltung der biologischen Vielfalt und der Schutz der natürlichen Ressourcen wie Boden, Wasser und Luft sind ohne Berücksichtigung der Landwirtschaft nicht denkbar. Kein anderer Wirtschaftssektor ist so eng mit allen drei Aspekten der Nachhaltigkeit verbunden.
Die Diskussion über die verschiedenen Facetten der nachhaltigen Entwicklung in der Landwirtschaft hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Ausgangspunkt waren zunächst umfassende Analysen und Situationsbeschreibungen, wobei der Schwerpunkt vor allem auf Ressourcenschutz und Biodiversität lag. Daneben gab es eine intensive Debatte über die angeblich beste Definition von nachhaltiger Landwirtschaft, aber wenn Nachhaltigkeit mehr als nur ein ethisch anspruchsvoller Begriff sein soll, müssen sogenannte Indikatoren zur Bewertung der verschiedenen Aspekte der nachhaltigen Entwicklung gefunden werden. Die Auswahl der Indikatoren ist hier aus zwei Gründen von herausragender Bedeutung. Zum einen müssen geeignete Maßeinheiten gefunden werden, um nachhaltige Entwicklung im nationalen und internationalen Rahmen als Grundlage für Vereinbarungen im wirtschaftlichen, aber auch im ökologischen Bereich vergleichen zu können. Zum anderen sind Indikatoren eine absolut notwendige Voraussetzung für eine nachhaltige Entwicklung auf nationaler und internationaler Ebene. Deshalb gab es in den letzten Jahren zahlreiche Versuche, geeignete Parameter zur Beurteilung der Nachhaltigen Entwicklung für verschiedene wirtschaftliche oder soziale Kontexte zu etablieren. Neben Veröffentlichungen in der wissenschaftlichen Literatur gibt es eine Reihe von Vorschlägen für einzelne Indikatoren oder umfassende Indikatorenkonzepte auf der Ebene nationaler und internationaler Organisationen (UNO, FAO, Kommission für Nachhaltige Entwicklung, Umweltbundesamt usw.), die sich auf die Umweltqualität, die landwirtschaftliche Produktion oder die Landnutzung beziehen.
Die vorliegende Studie verfolgt daher folgende Ziele:
- Dokumentation des aktuellen Diskussionsstandes zur Bewertung der Nachhaltigen Entwicklung in sozial-ökologischen Systemen.
- Kritische Bewertung der vorgeschlagenen Einzelindikatoren in Bezug auf Relevanz, methodische Validierung, Modellierungsmöglichkeiten und Grenzwertfähigkeit.
- Entwicklung eines Vorschlags zur Systematisierung und Verbesserung der Indikatorenkonzepte.
6.2.3. Indikatoren für sozial-ökologische Produktionslandschaften
Die Verwendung solcher Indikatoren bietet sich für einen allgemeinen Überblick an, da sie ein Schlüsselinstrument darstellen. Hier können Einzelpersonen und Gemeinschaften mit Hilfe der erprobten Methoden ihre Fähigkeit erhöhen, auf soziale Fragen zu reagieren. Sie können ihre wirtschaftlichen und ökologischen Zwänge angehen, um ihre ökologischen und wirtschaftlichen Bedingungen zu verbessern. Auf diese Weise kann die soziale und ökologische Widerstandsfähigkeit erhöht werden. Letztlich kann dies zu Fortschritten auf dem Weg zu einer Gesellschaft führen, die im Einklang mit der Natur steht.
Der Ansatz konzentriert sich hier auf "partizipative Bewertungsworkshops". Sie umfassen:
- Diskussion
- Ein Bewertungsverfahren für den Satz von zwanzig Indikatoren
Für die Verwendung der Indikatoren in der Vergangenheit sollten bestimmte Aspekte des Evaluationsprozesses hervorgehoben werden, um die Bedeutung und den Zweck der Indikatoren zu verstehen. Daher werden hier zwei grundlegende Konzepte untersucht:
- 1. "Sozio-ökologische Produktionslandschaften"
- 2. "Belastbarkeit".
6.2.4. Sozio-ökologische Produktion
Der Mensch hat die meisten Ökosysteme der Erde durch Produktionsaktivitäten wie die Landwirtschaft beeinflusst. Diese menschlichen Einflüsse werden oft als schädlich für die Umwelt angesehen, aber viele solcher Mensch-Natur-Interaktionen sind der Erhaltung der biologischen Vielfalt förderlich.
„Überall auf der Welt haben die Bemühungen lokaler Gemeinschaften über viele Jahre hinweg, sich an die umgebende Umwelt anzupassen, einzigartige und nachhaltige Landschaften und Meereslandschaften geschaffen, die die Menschen mit Gütern wie Nahrung und Treibstoff und Dienstleistungen wie Wasserreinigung und fruchtbaren Böden versorgt haben und gleichzeitig eine Vielfalt von Tier- und Pflanzenarten beherbergen. Diese Landschaften und Meereslandschaften sind aufgrund ihrer einzigartigen lokalen, klimatischen, geografischen, kulturellen und sozioökonomischen Bedingungen äußerst vielfältig. Sie werden jedoch gemeinhin als dynamische biokulturelle Mosaike von Lebensräumen sowie Land- und Meeresnutzungen charakterisiert, in denen der Mensch mit der Landschaft interagiert oder die biologische Vielfalt erhöht und die Menschen mit den für ihr Wohlergehen notwendigen Gütern und Dienstleistungen versorgt.“ (UNU-IAS, 2014: 2)
Sie werden „sozial-ökologische Produktionslandschaften“ (SEPLS) genannt. Sie sollen die biologische Vielfalt gewährleisten und lokale Gemeinschaften auf der ganzen Welt mit Ökosystemdienstleistungen versorgen.
„Das jüngste rasche Wachstum der menschlichen Nachfrage nach Nahrungsmitteln und anderen Gütern und die Veränderungen der sozioökonomischen Systeme aufgrund von Industrialisierung, Urbanisierung und Globalisierung haben verschiedene Produktionssektoren in stärker integrierte Systeme verwandelt, die einen intensiven Einsatz von externen Inputs wie chemischen Düngemitteln, Pestiziden und Herbiziden erfordern. Diese Auswirkungen können in Form eines Verlustes an Widerstandsfähigkeit und Nachhaltigkeit in produktiven Bereichen gemessen werden, und zwar in einem Ausmass, das das menschliche Wohlergehen aufgrund der Degradation der natürlichen Ressourcen und der Verringerung der Ökosystemleistungen bedroht.“ (UNU-IAS, 2014: 2)
6.2.5. Resilienz
Zusätzlich zu den Auswirkungen von Schocks, d.h. extremen Wetterereignissen, durch Waldbrände, Dürren und kurzfristige Störungen, werden Ökosysteme durch relativ allmähliche, aber kontinuierliche Veränderungen des Klimas und der soziokulturellen Praktiken und Institutionen beeinflusst. Sozio-ökologische Systeme sind so unterschiedlich, dass Einzelpersonen oder Gemeinschaften sich gegen Schäden am Ökosystem wehren oder sich davon erholen können. Die Kapazität solcher Systeme ist die so genannte „Resilienz“. Auf diese Weise können Systeme eine entscheidende Rolle bei der Sicherung langfristiger Ökosystemleistungen und nachhaltiger Produktionssysteme spielen, die sowohl lokalen Gemeinschaften zugute kommen als auch zu den globalen Zielen der nachhaltigen Entwicklung beitragen.
Die Stärkung der Widerstandsfähigkeit des SEPLS durch lokale Gemeinschaften sichert das langfristige Überleben des von der Gemeinschaft verwalteten SEPLS. Sie verfügen über eine angemessene Bewirtschaftung und Nutzung der natürlichen Ressourcen, und die biologische Vielfalt definiert sie als widerstandsfähige Systeme. Dennoch stehen viele Gemeinschaften vor wachsenden Herausforderungen bei der Erhaltung dieser Landschaften und der sozialen und ökologischen Prozesse zu ihrer Erhaltung. Angesichts der raschen und oft miteinander verbundenen Veränderungen der sozioökonomischen Systeme, da diese durch den zunehmenden Klimawandel und die Verschlechterung der Ökosysteme beschleunigt werden. Gemeinschaften sind primäre Verwalter von Prozessen und Ressourcen, und sie müssen bestehende Managementpraktiken und -institutionen stärken und innovativ sein. Das liegt daran, dass sie sich an diese Veränderungen anpassen und gleichzeitig die soziale und ökologische Widerstandsfähigkeit von Landschaften und Meereslandschaften wiederherstellen oder stärken müssen.
Die Widerstandsfähigkeit von SEPLS ist ein Produkt ökologischer, sozialer, kultureller und wirtschaftlicher Systeme, die dynamisch und synergetisch miteinander verbunden sind. Verbesserungen der Ökosystemleistungen können zum Beispiel die Einführung neuer Methoden der Bewirtschaftung natürlicher Ressourcen oder neuer Arten der Vielfalt von Nutzpflanzen, Tieren und verwandten Arten erfordern. Für eine größere Nachhaltigkeit von Agrarökosystemen kann es auch erforderlich sein, sich mit Fragen des Zugangs und der Gerechtigkeit zu befassen, wie z.B. die Unterstützung der Rolle der Frauen bei der Auswahl, Produktion und Vermarktung von Nutzpflanzen.
Wenn wir von interdependenten Sozial- und Umweltsystemen sprechen, müssen sie in der Lage sein, Komplexität und ständige Anpassung zu akzeptieren und zu bewältigen. Damit verbunden sind ländliche Gemeinschaften, die auf die vielfältigen Funktionen mit Produkten und Dienstleistungen angewiesen sind, die ihre Landschaften bieten. Resilienzindikatoren sollen den Gemeinschaften helfen, sich für die Planung, Umsetzung, Überwachung und Bewertung ihrer Produktion und ihres Ressourcenmanagements verantwortlich zu fühlen. „Das Wissen und die Einsichten, die aus diesen Aktivitäten gewonnen werden, können dann genutzt werden, um lokale Visionen und Strategien für belastbare Landschaften und produktive Ökosysteme als Input für übergreifende Politiken und Programme zu liefern, die sich auf die Lebensgrundlagen der Gemeinschaften und die weitere Planung für Naturschutz und Ressourcenmanagement auswirken.“ (UNU-IAS, 2014: 8)
6.2.6. Über die Indikatoren
Die Widerstandsfähigkeit lokaler Gemeinschaften nimmt zu, wenn sie ein umfassenderes Verständnis für den Zustand und die Veränderungen der Bedingungen ihrer Landschaften und Meeresumwelt gewinnen. Da diese Belastbarkeit jedoch ein sehr komplexer und vielschichtiger Prozess ist, kann sie schwer zu messen sein. Dieses Toolkit stellt einen Ansatz zur Überwachung von SEPLS vor, bei dem eine Reihe von Indikatoren verwendet wird, die ein allgemeines Maß für die SEPLS-Resilienz definieren.
„Die Belastbarkeitsindikatoren für SEPLS bestehen aus einem Satz von 20 Indikatoren, die verschiedene Aspekte der Schlüsselsysteme - Umwelt, Landwirtschaft, Kultur und sozioökonomische Aspekte - erfassen sollen. Sie umfassen sowohl qualitative als auch quantifizierbare Indikatoren, aber die Messung basiert auf den Beobachtungen, Vereinbarungen, Wahrnehmungen und Erfahrungen der lokalen Gemeinschaften selbst. Sie sollten flexibel in ihrer Anwendung sein und können an die spezifische Landschaft oder Meeresumwelt und die damit verbundenen Gemeinschaften angepasst werden.“ (UNU-IAS, 2014: 9)
Für die räumliche Ausdehnung dieser SEPLS im Rahmen der Verwendung der Indikatoren müssen die Mitglieder der lokalen Gemeinschaften selbst das Gebiet bestimmen, von dem sie für ihr Überleben und ihren Lebensunterhalt abhängen. In der Regel handelt es sich dabei um das Mosaik der Landnutzung, aus dem die Gemeinschaften ihre Güter und Dienstleistungen beziehen. Das bedeutet, dass sie direkt oder indirekt davon abhängen. Gleichzeitig üben sie aber auch einen direkten Einfluss auf die Ressourcenbasis aus. Dass sie regelmässige Wechselwirkungen mit der natürlichen Biodiversität haben. Ein SEPLS kann durch administrative Grenzen, wie z.B. einen Nationalpark oder nationale Grenzen, oder durch ein Wassereinzugsgebiet als geographische Grenze oder durch andere Faktoren abgegrenzt werden.
Die Indikatoren zielen darauf ab, die Punkte zu definieren, die für die Widerstandsfähigkeit eines SEPLS wesentlich sind, und bieten den Gemeinschaften einen Rahmen, um sozio-ökologische Prozesse zu diskutieren und zu analysieren. (UNU-IAS, 2014: 9) „Dies bezieht sich auf kritische Lebens- und Entwicklungsziele wie Ernährungssicherheit, landwirtschaftliche Nachhaltigkeit, institutionelle und menschliche Entwicklung, Bereitstellung von Ökosystemleistungen und Erhaltung der biologischen Vielfalt, Stärkung von Organisationen auf Gemeinde- und Landschaftsebene sowie Landschaftsgestaltung im Hinblick auf Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit. Die Diskussion von Indikatoren innerhalb der Gemeinden regt den Austausch von Wissen und Analysen an, die Schlüsselfaktoren bei der Schaffung von Sozialkapital für Landschaftsgestaltung, -planung und -management sind, und fördert die Eigenverantwortung der Gemeinden für diesen Prozess.“ Die periodische Anwendung dieser Indikatoren ermöglicht die Bewertung der Fortschritte bei der Erreichung der Ziele dieser Entwicklung und der nachhaltigen Bewirtschaftung sowie die Ermittlung vorrangiger Maßnahmen für lokale Innovation und anpassungsfähiges Management. (UNU-IAS, 2014: 9)
Die Indikatoren können den lokalen Gemeinschaften und anderen Interessengruppen in den folgenden Bereichen Input liefern:
- Verständnis der Widerstandsfähigkeit von SEPLS. Die Indikatoren bieten einen analytischen Rahmen für das Verständnis der Resilienz und ihres Status und der Veränderungen im SEPLS. Sie werden in Begriffen definiert und gemessen, die für lokale Gemeinschaften leicht zu verstehen und anzuwenden sind und für nachfolgende Analysen angepasst werden können. Durch die Bewertung der aktuellen Bedingungen und Trends in verschiedenen Aspekten von SEPLS können die Anwender die Resilienz als ein multidimensionales Ziel verstehen.
- Die Indikatoren können dazu beitragen, soziale Prozesse, Institutionen und Praktiken der Landnutzung, des Naturschutzes und der Innovation zu identifizieren und zu verfolgen, die Teil der Anpassungs- und Veränderungsfähigkeit eines belastbaren Systems sind. Durch die Überprüfung und Erörterung von Bewertungsergebnissen können Gemeinschaften lernen, auf welche Bereiche und Faktoren sie sich konzentrieren sollten, zu denen Komponenten der landwirtschaftlichen Biodiversität, der Ernährungssicherheit, der Ökosystemleistungen, der Lebensgrundlagen, der Regierungsführung und andere gehören können.
- Verbesserung der Kommunikation zwischen den Interessengruppen.
- Befähigung der Gemeinschaften, Entscheidungen zu treffen und adaptiv zu verwalten.
- Die Verwendung von Indikatoren erleichtert einen kontinuierlichen Diskussions- und Beteiligungsprozess innerhalb lokaler Gemeinschaften und führt zu Erkenntnissen darüber, was funktioniert und was nicht. Diese Art von adaptivem Managementmodell fördert ein größeres Gefühl der Eigenverantwortung unter den Menschen, die im SEPLS leben, und ermutigt sie, auf der Ebene der Politikgestaltung tätig zu werden. Die Verwendung der Indikatoren als Diskussionsrahmen trägt auch zur Konsensbildung darüber bei, was getan werden muss, um die Widerstandsfähigkeit der gesamten Landschaft aufzubauen oder zu verbessern und die Entscheidungsfindung und Umsetzung zu lenken. (UNU-IAS, 2014: 9)
6.2.7. Wer kann von der Verwendung der Indikatoren profitieren?
Obwohl die Indikatoren in erster Linie für die Verwendung durch lokale Gemeinschaften konzipiert sind, haben sie das Potenzial, für andere wie NGOs, Entwicklungsagenturen und politische Entscheidungsträger wertvolle Instrumente zu sein. Die Indikatoren können auch für Forscher nützlich sein, um SEPLS zu verstehen und zu erfahren, wie Gemeinschaften ihre Landschaft oder Meereslandschaft sehen. Die Rolle des Vermittlers kann in Situationen, in denen es für die Gemeinschaften schwierig ist, die Indikatoren allein zu verwenden, wichtiger sein.
Im Folgenden sind einige mögliche Vorteile für verschiedene Nutzer aufgeführt.
Lokale Gemeinschaften:
- Verbesserung des gemeinsamen Verständnisses von SEPLS (z.B. Bedingungen und Bedrohungen für SEPLS) innerhalb und außerhalb der Gemeindemitglieder.
- Ermittlung vorrangiger Themen und Maßnahmen zur Aufrechterhaltung von SEPLS, die der Existenzsicherung und dem Wohlergehen zugute kommen, und Bewertung der bisherigen Bemühungen der Gemeinschaft.
- Beitrag zur Stärkung des Vertrauens und des Sozialkapitals in Gemeinschaften und zur Konfliktlösung.
- Information von politischen Entscheidungsträgern, Spendern und relevanten Interessengruppen über die Situation ihres SEPLS und über Bereiche für eine effizientere Unterstützung.
Erfahrungsaustausch mit Gemeinden, die die Indikatoren ausprobiert haben, NGOs und Entwicklungsagenturen, die die Projekte im SEPLS umsetzen:
- Verbesserung des Verständnisses der Belastbarkeit aus der Perspektive der lokalen Gemeinschaften.
- Förderung partizipatorischer Prozesse.
- Überwachung und Bewertung von Projektinterventionen zum Schutz der Resilienz und der biologischen Vielfalt und Identifizierung von Gebieten, die unterstützt werden sollen.
- Effektivere Kommunikation mit politischen Entscheidungsträgern und Gebern über die Situation des SEPLS, mit dem sie zusammenarbeiten, und über die Bereiche, in denen Unterstützung benötigt wird.
Politische Entscheidungsträger und Projektplaner:
- Besseres Verständnis der lokalen Bedingungen aus der Perspektive der lokalen Gemeinschaften.
- Bessere Kommunikation mit lokalen Gemeinschaften.
- Ermittlung von verbesserungsbedürftigen Bereichen und deren Berücksichtigung bei der Politikgestaltung, Planung und anderen Entscheidungsprozessen.
- Erhöhung der Kohärenz zwischen verschiedenen Projektstandorten durch Anwendung eines gemeinsamen analytischen Rahmens und gemeinsamer Instrumente.
Forscher:
- Verbesserung des multidimensionalen Verständnisses der lokalen Bedingungen aus der Perspektive der lokalen Gemeinschaften.
- Vertiefung des Verständnisses der Belastbarkeit durch Untersuchung der Ergebnisse von verschiedenen Standorten.
- Identifizierung von Lücken in der Forschung.
Indikatoransätze werden heute überall und zunehmend in verschiedenen Sektoren und Kontexten verwendet:
Beispielsweise spielen sie auf globaler und nationaler Ebene eine wichtige Rolle bei der Überwachung der Fortschritte auf dem Weg zu bestimmten Zielen und Vorgaben. So wurden beispielsweise rund 100 Indikatoren aufgelistet, um den Fortschritt bei der Umsetzung des Strategischen Plans zur biologischen Vielfalt 2011-2020 und der Aichi-Biodiversitätsziele zu überwachen, die 2010 auf der CBD-COP 10 in Japan angenommen wurden, um einen Handlungsrahmen für alle Interessengruppen zum Schutz der biologischen Vielfalt und zur Verbesserung ihres Nutzens für die Menschen zu schaffen. Bei den MDG-Indikatoren handelt es sich um einen Satz von 60 Indikatoren zur Messung der Fortschritte bei der Erreichung der Millenniums-Entwicklungsziele (MDGs), acht internationale Entwicklungsziele, die bis 2015 erreicht werden sollen, um die extreme Armut zu bekämpfen. Die Vereinten Nationen einigten sich auf der Rio+20-Konferenz im Jahr 2012 auf die Entwicklung einer Reihe von Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) und arbeiten derzeit an der Definition der Ziele und relevanten Indikatoren, die 2015 angenommen werden sollen.
Die Indikatoren müssen quantitativ sein und gleichzeitig dürfen sie Daten in einem größeren räumlichen Maßstab aggregieren. Sie müssen einen Vergleich über Raum und Zeit auf nationaler und globaler Ebene ermöglichen. Indikatoren müssen auch wissenschaftlich valide und objektiv sein, wobei die Bewertung häufig von Experten durchgeführt wird. Dies steht nicht im Widerspruch zu ihnen. Im Gegensatz zu diesen übergreifenden Indikatoren sind die im SEPLS eingeführten Resilienzindikatoren für die Verwendung auf lokaler Ebene bestimmt, d.h. sie umfassen sowohl qualitative als auch quantifizierbare Indikatoren. Die Messung basiert auf den Beobachtungen, Wahrnehmungen und Erfahrungen der lokalen Gemeinschaften selbst.
Diese lokalen Beobachtungen können durch wissenschaftliche Daten und Informationen aus globalen und nationalen Beobachtungen und Datensätzen sowie aus früheren Studien ergänzt werden. Es sollte jedoch möglich sein, externe Daten in die lokale Wissensbasis zu integrieren. Die Indikatoren in diesem Toolkit bieten den lokalen Gemeinschaften einen Rahmen, in dem sie im Rahmen des adaptiven Managementprozesses sowohl den aktuellen Zustand der Belastbarkeit als auch potenzielle Bereiche für Verbesserungen diskutieren können. Dies kann zu raschen und proaktiven Bemühungen der lokalen Gemeinschaften führen, die Widerstandsfähigkeit ihrer produktiven und marinen Landschaften zu stärken. Es bietet auch einen konsistenten Prozess für die Überwachung der Belastbarkeit der Landschaft oder der Meereslandschaft und die Umsetzung von Maßnahmen, um Komponenten und Faktoren anzugehen, die zu einer verminderten Belastbarkeit führen. (UNU-IAS, 2014: 9)
Die Widerstandsfähigkeitsindikatoren in SEPLS überschneiden sich teilweise und ergänzen einige der übergreifenden Indikatoren. Resiliente Landschaften, die sich aus der Anwendung der Indikatoren und der Umsetzung von Maßnahmen ergeben, die sich aus ihrer Anwendung ergeben, tragen auch zu globalen und nationalen Zielen bei, wie sie in der CBD (z.B. den Aichi Biodiversitätszielen und den nationalen strategischen Aktionsplänen zur biologischen Vielfalt) und im Internationalen Vertrag der FAO über pflanzengenetische Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft festgelegt sind. Die Nachhaltigkeitsindikatoren für sozio-ökologische Produktionslandschaften und Meereslandschaften (SEPLS) und dieses Toolkit wurden in Zusammenarbeit im Rahmen der Internationalen Partnerschaft für die Satoyama-Initiative (IPSI) entwickelt.
Als internationale Plattform, die für Organisationen offen ist, die sich mit SEPLS befassen, hat IPSI versucht, Synergien bei der Umsetzung ihrer jeweiligen Aktivitäten sowie anderer im Rahmen der Initiative geplanter Aktivitäten zu fördern. Bis heute wurden im Rahmen der IPSI über 20 IPSI-Kooperationsaktivitäten initiiert, darunter auch dieses Toolkit und seine Indikatoren. (UNU-IAS, 2014: 9)
Sie wurden von der
- Bioversität International,
- Institut für globale Umweltstrategien (IGES),
- Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP) und
- UNU-IAS durchgeführt wurden. (UNU-IAS, 2014: 9)
Die Kritik an der Kooptierung bezieht sich auf die Frage, ob die Gegenseitigkeitsgesellschaft noch wettbewerbsfähig ist. Diese Diskussion geht viel weiter, z. B. bei den Problemen der Erhöhung der Gerechtigkeit. Aus wirtschaftlicher Sicht gibt es jedoch einige Gründe, diese Form der Versicherung beizubehalten und mit der Aktiengesellschaft zu konkurrieren.
6.2.8. Die zwanzig Toolkits
(1) Landschafts-/Meereslandschaftsvielfalt
Die Landschaft oder Meereslandschaft setzt sich aus einer Vielfalt/Mosaik von natürlichen Ökosystemen (terrestrisch und aquatisch) und Landnutzungen zusammen.
Beispiele:
Natürliche Ökosysteme: Berge, Wälder, Grasland, Feuchtgebiete, Seen, Flüsse, Küstenlagunen, Flussmündungen, Korallenriffe, Seegraswiesen und Mangrovenwälder.
Landnutzung: Hausgärten, kultivierte Felder, Obstgärten, (saisonale) Weiden, Heuwiesen, Aquakultur, Forstwirtschaft und Agroforstwirtschaft, Bewässerung, Kanäle, Wasserbrunnen.
(2) Schutz des Ökosystems
Gebiete innerhalb der Landschafts- oder Meereslandschaft werden aufgrund ihrer ökologischen und/oder kulturellen Bedeutung geschützt.
Hinweis: Der Schutz kann formell oder informell sein und traditionelle Formen des Schutzes wie heilige Stätten umfassen.
Beispiele:
Strenge Naturreservate, Nationalparks, Wildnisgebiete, Kulturerbestätten, gemeinschaftlich geschützte Gebiete, Meeresschutzgebiete, Gebiete mit beschränkter Nutzung, heilige Stätten, Weidereservate, Regeln und Vorschriften, um Außenstehende von der (saisonalen) Nutzung natürlicher Ressourcen auszuschließen, usw.
(3) Ökologische Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Komponenten der Landschaft/des Meeres
Ökologische Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Komponenten der Landschaft oder der Meereslandschaft werden bei der Bewirtschaftung natürlicher Ressourcen berücksichtigt.
Beispiele:
Gebiete, die für die Erhaltung oder Wiederherstellung vorgesehen sind, andere Gebiete durch Bestäubung, Schädlingsbekämpfung, Nährstoffkreislauf und Zunahme der Tierpopulation. Wälder schützen Wasserquellen und dienen als Futter-, Medizin- und Nahrungsquelle. Landwirtschaftliche Aktivitäten können andere Teile der Landschaft beeinflussen. Meeresschutzgebiete können die Meerespopulationen auch in anderen Fischereigebieten erhöhen (Spillover-Effekte).
(4) Erholung und Regeneration der Landschaft/des Meeres
Die Landschaft oder Meereslandschaft hat die Fähigkeit, sich von Umweltschocks und -belastungen zu erholen und zu regenerieren.
Beispiele:
Ausbrüche von Schädlingen und Krankheiten; Extremwetterereignisse wie Stürme, extreme Kälte, Überschwemmungen und Dürren; Erdbeben und Tsunamis; Waldbrände.
(5) Vielfalt des lokalen Nahrungsmittelsystems
Zu den Lebensmitteln, die in der Landschaft oder im Meer verzehrt werden, gehören Lebensmittel, die vor Ort angebaut, aus örtlichen Wäldern gesammelt und/oder aus örtlichen Gewässern gefischt werden.
Beispiele:
Getreide, Gemüse, Früchte, Nüsse, Wildpflanzen, Pilze, Beeren, Vieh, Milch, Milchprodukte, Wildtiere/Insekten, Fisch, Algen usw.
(6) Erhaltung und Nutzung lokaler Pflanzensorten und Tierrassen. Haushalte und/oder Gemeinschaftsgruppen erhalten eine Vielfalt an lokalen Nutzpflanzensorten und Tierrassen.
Beispiele:
Saatguthüter, fachkundige Tierzüchter, Tierzuchtgruppen, Hausgärten, kommunale Saatgutbanken.
(7) Nachhaltige Bewirtschaftung gemeinsamer Ressourcen
Gemeinsame Ressourcen werden nachhaltig bewirtschaftet, um Raubbau und Erschöpfung zu vermeiden.
Beispiele:
Weideregelungen; Fischfangquoten; nachhaltiger Tourismus; Kontrolle der Wilderei und des illegalen Holzeinschlags; oder die Ernte von Waldprodukten.
(8) Innovation in der Landwirtschaft und Erhaltungspraktiken
Neue Praktiken in Landwirtschaft, Fischerei und Forstwirtschaft werden entwickelt, übernommen und verbessert und/oder traditionelle Praktiken werden wiederbelebt.
Beispiele:
Einführung wassersparender Maßnahmen wie Tröpfchenbewässerung oder Wasserernte; Diversifizierung der Anbausysteme; Einführung oder Wiedereinführung dürre- oder salztoleranter Nutzpflanzen; ökologische Landwirtschaft; Terrassierung; Wiedereinführung einheimischer Arten; Verlagerung und Rotation von Grasland; Wiederaufforstung; Wiederanpflanzung von Korallen, Seegras und Mangroven; Fischhäuser; selektive Fanggeräte.
(9) Traditionelles Wissen in Bezug auf Biodiversität
Lokales Wissen und kulturelle Traditionen im Zusammenhang mit der Biodiversität werden von Älteren und Eltern an junge Menschen in der Gemeinde weitergegeben.
Beispiele:
Lieder, Tänze, Rituale, Feste, Geschichten, lokale Terminologie im Zusammenhang mit Land und Biodiversität; Spezifisches Wissen über Fischfang, Anbau und Ernte sowie die Verarbeitung und das Kochen von Lebensmitteln; Wissen, das in den Lehrplänen der Schulen enthalten ist.
(10) Dokumentation von biodiversitätsbezogenem Wissen
Die Biodiversität in der Landschaft oder Meereslandschaft, einschließlich der landwirtschaftlichen Biodiversität, und das damit verbundene Wissen wird dokumentiert, gespeichert und den Mitgliedern der Gemeinschaft zur Verfügung gestellt.
Beispiele:
Register für traditionelles Wissen; Ressourcenklassifizierungssysteme; Biodiversitätsregister der Gemeinschaft; Feldschulen der Landwirte; Tierzuchtgruppen; Weide-Co-Managementgruppen; Saatgutaustauschnetzwerke (Tier- und Saatgutmessen); Saisonkalender.
(11) Wissen von Frauen
Das Wissen, die Erfahrungen und Fähigkeiten von Frauen werden in der Gemeinschaft anerkannt und respektiert. Frauen verfügen oft über spezifische Kenntnisse, Erfahrungen und Fähigkeiten in Bezug auf die biologische Vielfalt, ihre Nutzung und ihr Management, die sich von denen der Männer unterscheiden.
Beispiele:
Know-how über die Produktion bestimmter Nutzpflanzen; Sammeln und Nutzung von Heilpflanzen; Pflege von Tieren.
(12) Rechte in Bezug auf die Bewirtschaftung von Land/Wasser und anderen natürlichen Ressourcen
Die Rechte über Land/Wasser und andere natürliche Ressourcen sind klar definiert und werden von relevanten Gruppen und Institutionen, z.B. Regierungen und Entwicklungsagenturen, anerkannt. Die Anerkennung kann durch Politik, Gesetz und/oder durch Gewohnheitsrecht formalisiert werden.
Beispiele:
Landnutzungsgruppen; kommunale Forstausschüsse; Co-Management-Gruppen oder Gemeinschaften.
(13) Gemeindebasierte Landschafts-/Meeresverwaltung
Die Landschaft oder das Meer verfügt über fähige, rechenschaftspflichtige und transparente lokale Institutionen für die wirksame Verwaltung ihrer Ressourcen und der lokalen biologischen Vielfalt.
Beispiele:
Organisationen, Regeln, Politiken, Vorschriften und Durchsetzung, die auf das Ressourcenmanagement abzielen; traditionelle Autoritäten und gewohnheitsmäßige Regeln; Co-Management-Vereinbarungen, z.B. gemeinsame Waldbewirtschaftung, zwischen der lokalen Bevölkerung und der Regierung.
(14) Soziales Kapital in Form von Zusammenarbeit über die Landschaft/den Meeresboden
Einzelpersonen innerhalb und zwischen Gemeinschaften sind durch Netzwerke verbunden und koordiniert, die Ressourcen verwalten und Materialien, Fähigkeiten und Wissen austauschen.
Beispiele:
Selbsthilfegruppen; Gemeindevereine und -gruppen (Frauen- und Jugendgruppen); Interkommunale Netzwerke; Vereinigungen von Verbänden mit Schwerpunkt auf der Bewirtschaftung natürlicher Ressourcen.
(15) Soziale Gerechtigkeit (einschließlich Geschlechtergerechtigkeit)
Die Rechte und der Zugang zu Ressourcen und Möglichkeiten für Bildung, Information und Entscheidungsfindung sind für alle Gemeindemitglieder, einschließlich Frauen, auf Haushalts-, Gemeinde- und Landschaftsebene fair und gleichberechtigt.
Beispiele:
Hochland- und Tieflandgemeinden; Gemeindemitglieder, die verschiedenen sozialen oder ethnischen Gruppen angehören; die Stimmen und Entscheidungen von Frauen werden bei der Entscheidungsfindung im Haushalt und bei Gemeindetreffen, bei denen Entscheidungen über kollektive Aktionen getroffen werden, berücksichtigt.
(16) Sozioökonomische Infrastruktur
Die sozioökonomische Infrastruktur ist den Bedürfnissen der Gemeinschaft angemessen.
Beispiele:
Schulen, Krankenhäuser, Straßen und Verkehr; sicheres Trinkwasser; Märkte; Elektrizitäts- und Kommunikationsinfrastruktur.
(17) Menschliche Gesundheit und Umweltbedingungen
Der Gesamtzustand der menschlichen Gesundheit in der Gemeinde ist zufriedenstellend, auch unter Berücksichtigung der vorherrschenden Umweltbedingungen.
Beispiele:
Fehlen oder regelmäßiges Auftreten von Krankheiten; Häufigkeit von Krankheitsausbrüchen, die eine große Zahl von Menschen betreffen; Fehlen/Vorhandensein von Umweltbelastungen wie Verschmutzung, Mangel an sauberem Wasser, Exposition gegenüber extremen Wetterereignissen.
(18) Einkommensvielfalt
Menschen in der Landschaft oder im Meer sind an einer Vielzahl von nachhaltigen einkommensschaffenden Aktivitäten beteiligt. Hinweis: Die Vielfalt der wirtschaftlichen Aktivitäten kann den Haushalten bei unerwarteten Einbrüchen, Katastrophen, Veränderungen der Umweltbedingungen usw. helfen.
(19) Auf Biodiversität basierende Lebensgrundlagen
Die Verbesserung des Lebensunterhalts in der Landschaft oder der Meereslandschaft betrifft die innovative Nutzung der lokalen biologischen Vielfalt.
Beispiele:
Kunsthandwerk unter Verwendung lokaler Materialien, z.B. Holzschnitzerei, Korbflechterei, Malerei, Weberei usw.; Ökotourismus; Verarbeitung lokaler Lebensmittel, Bienenzucht usw.
(20) Sozio-ökologische Mobilität
Haushalte und Gemeinden sind in der Lage, umzuziehen, um von Verschiebungen der Produktionsmöglichkeiten zu profitieren und Landdegradierung und Raubbau zu vermeiden.
Beispiele:
Verlagerung von Anbau- und Fruchtfolgepraktiken; Wechsel zwischen Landwirtschaft und Viehhaltung / Fischerei; saisonale Wanderung der Hirten; Verlagerung der Fischgründe; Erhaltung von Reserveflächen für Zeiten der Not.
6.2.9. Bildung als der umfassende Faktor
„Der Zusammenhalt und die soziale Entwicklung unserer Gesellschaft, unser Wohlstand und die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft hängen zunehmend von der Bedeutung der Bildung ab. Bildung ist der entscheidende Faktor für die Zukunft unseres Landes, aber auch für die Chancen jedes einzelnen Menschen.“ (Koalitionsvereinbarung vom 11. November 2005)
Neben der Bildung ist aber auch der weit gefasste Kulturbegriff entscheidend: „Der Ausschuss ist der Auffassung, dass Kultur für die Zwecke der Umsetzung von Artikel 15 Absatz 1 Buchstabe a unter anderem Lebensweisen, Sprache, mündliche und schriftliche Literatur, Musik und Gesang, nonverbale Kommunikation, Religion oder Glaubenssysteme, Riten und Zeremonien, Sport und Spiel, Produktionsmethoden oder Technologie, natürliche und vom Menschen geschaffene Umwelt, Nahrung, Kleidung und Obdach sowie die Künste, Bräuche und Traditionen umfasst, durch die Einzelpersonen, Gruppen von Einzelpersonen und Gemeinschaften ihre Menschlichkeit und den Sinn, den sie ihrer Existenz geben, zum Ausdruck bringen und ihre Weltsicht aufbauen, die ihre Begegnung mit den äußeren Kräften, die ihr Leben beeinflussen, darstellt. Kultur formt und spiegelt die Werte des Wohlergehens und des wirtschaftlichen, sozialen und politischen Lebens von Einzelpersonen, Gruppen von Einzelpersonen und Gemeinschaften wider.“
Dieses Verständnis von Kultur umfasst nicht nur Kunst und Literatur, sondern auch Lebensweisen, Werte, Traditionen und Überzeugungen. Das Prinzip der kulturellen Vielfalt spielt in diesem Zusammenhang eine zentrale Rolle: „Der Schutz der kulturellen Vielfalt ist ein ethischer Imperativ, der untrennbar mit der Achtung der Menschenwürde verbunden ist. Er impliziert ein Bekenntnis zu den Menschenrechten und Grundfreiheiten und erfordert die volle Umsetzung der kulturellen Rechte. Dazu gehören nicht nur Kunst und Literatur, sondern auch Lebensweisen, grundlegende Menschenrechte, Wertesysteme, Traditionen und Überzeugungen.“